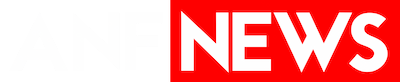Seit der Besetzung des ehemaligen Kantons Efrîn im Nordwesten von Syrien 2018 ist die für interreligiöse und multiethnische Vielfalt einst mustergültige Region, die inmitten eines brutal geführten Bürgerkriegs als sicherste im ganzen Land galt, ein Ort der Unterdrückung und Verfolgung. Rund eine halbe Millionen Menschen, darunter etwa 150.000 Binnenflüchtlinge, wurden von der türkischen Armee und den mit ihr verbündeten Dschihadistenmilizen aus Efrîn vertrieben. Ein Großteil strandete im benachbarten Şehba, das von Kriegshandlungen bereits zerstört und vom IS großflächig vermint worden war. Bis heute halten sich etwa 200.000 Efrîn-Vertriebene in der wüstenähnlichen Region auf, die meisten leben in unzulänglichen, baufälligen Häusern in vormals entvölkerten Ruinendörfern. Etwa 16.000 Menschen wohnen in Zeltstädten. Doch auch unter den widrigsten Umständen leben sie ihre Utopie einer pluralistischen und dezentralen Demokratie der Völker, die dem nahöstlichen Mosaik entspricht, weiter. Das System der kommunalen Selbstverwaltung wird selbst in den Zeltlagern umgesetzt.
Ein Nomadenzeltdorf für die „Roma von Efrîn“
Seit der Revolution vom 19. Juli 2012 stellt die Kommune die Basis des demokratischen Systems in den Autonomiegebieten von Syrien dar. Es handelt sich dabei um radikaldemokratische Räte, die sich über ihre Komitees zu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens organisieren und damit auch ein Verwaltungssystem verkörpern: Jugend, Bildung, Soziales, Gesundheit, Ökonomie, Infrastruktur – aber auch Sicherheit, Selbstverteidigung und Aussöhnung. Insbesondere Efrîn verfügte über eine hochgradig in Kommunen vertretene und organisierte Gesellschaft. In Şehba passten die Vertriebenen ihre basisdemokratischen Partizipationsmöglichkeiten jedoch relativ schnell den neuen Gegebenheiten an. Eine der Zeltstädte, in der das Gesellschaftsmodell der Rojava-Revolution beispielgebend praktiziert wird, ist das Camp Efrîn. Das auch als Kampa Koçera bekannte Lager liegt im Kreis Ehdas, unweit von Tel Rifat, und beherbergt die „Roma von Efrîn“. Etwa 700 Menschen leben in dem Camp. Es wurde auf ihren eigenen Wunsch hin von der Selbstverwaltung als eine Art Nomadenzeltdorf errichtet, damit sie ihre eigenen Besonderheiten wenigstens zum Teil beibehalten konnten.
Efrîns Dom aus Êlih und Xarpêt
In Efrîn lebten die Dom, wie die Roma im Nahen und Mittleren Ostens heißen, in den Vierteln Eşrefiyê und Koçera (alter Name: Zidiye). Dorthin gelangt sind sie aus dem Raum Êlih (tr. Batman) und Xarpêt (Elazığ) in Nordkurdistan. Als kommerzielle nomadisierende Gemeinschaft, die sich vor und auch während der Zeit des Osmanischen Reichs frei durch die Region bewegte und in verschiedenen Handwerken arbeitete, hatten die Kurdisch sprechenden Dom – einige, teils von Vorurteilen überlagerte und diskriminierende Fremdbezeichnungen lauten Qereçî, Mitirb oder Aşiq – durch die Bildung von Nationalstaaten zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen großen Einschnitt hinnehmen müssen. Die neu gezogenen Grenzen beeinflussten ihren bisherigen Lebensstil enorm und führten auch zur Trennung von Familien. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Lagers Koçera beziehungsweise ihre Vorfahren gehören zu jenen Dom, denen es Anfang der 1950er Jahre nicht mehr gelang, die Grenze zurück in den Norden zu überqueren, und die in Rojava blieben. In Syrien gibt es allerdings seit hunderten von Jahren Gemeinden von Dom.
Die Dom-Gemeinde Efrîns war von Beginn an Teil der Revolution von Rojava und brachte sich aktiv in den Aufbau eines neuen Gesellschaftsmodells ein. Ihre Mitglieder lehnten das Regime ab, unter dem sie Verfolgung und Ausgrenzung ausgesetzt waren, das sie ausschloss und an den Rand der Gesellschaft drängte. „Wir sind es gewohnt, in Freiheit zu leben. Der 19. Juli markiert daher auch den Beginn unserer Revolution”, beschreibt es Kamber Dede, Ko-Vorsitzender der Kommune in Camp Koçera. Denn es sei der Anfang einer kollektiven Auflehnung gegen das unterdrückerische System gewesen. ANF hat das Lager anlässlich der jüngsten Bombardements auf Tel Rifat durch den Nato-Staat Türkei besucht. Die schwersten Angriffe ereigneten sich am 15. Februar, dem Jahrestag der Verschleppung von Abdullah Öcalan in die Türkei. Fünf zivile Personen, darunter drei Minderjährige, wurden durch Granaten verletzt. In Koçera schlug wie durch ein Wunder keine Artillerie ein.
„Die Türkei will in Şehba das wiederholen, was sie bereits in Efrîn tat und weiterhin tut: töten, vertreiben, annektieren“, antwortet Dede auf die Frage nach den Motiven für die fast täglichen Angriffe auf die Region. Es gehe darum, Şehba de facto in türkisches Staatsgebiet einzuverleiben. Efrîn und andere Besatzungszonen glichen längst einem Protektorat, und auch die verbliebenen Autonomiegebiete sollen vom Rest Syriens physisch ausgegrenzt werden. „Dafür ist der Türkei jedes Mittel recht. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Angriffe wir hier schon erleben mussten. Dennoch verbleiben wir in Şehba, selbst unter den schwierigsten Bedingungen”, sagt Kamber Dede. Denn Şehba sei das Tor nach Efrîn. „Und früher oder später kehren wir zurück. Es ist unsere Heimat und der einzige Ort, an dem wir wirklich frei waren.“
„Bis zur Befreiung von Efrîn bleiben wir hier“
Andere Bewohner:innen äußern sich ähnlich. Emine Kemal Muhammed, eine Frau Ende vierzig, die einen Sohn in den Reihen der YPG bei der Verteidigung Efrîns verloren hat, zeigt sich empört über die Ignoranz des „Westens“ angesichts türkischer Angriffe auf die Vertriebenenlager. „Bei den jüngsten Bombardierungen verfehlte eine der Granaten nur knapp unser Camp. Die Geschosse schlugen allerdings in der Nähe des Eingangs ein. Wir hatten Glück, dass Menschen nicht getroffen worden sind“, sagt Muhammed mit energischen Worten. Sie fährt fort: „Wir haben 58 Tage Angriffskrieg auf Efrîn getrotzt und Widerstand gegen die Invasoren geleistet. Wir haben Gefallene gegeben und unsere Existenz verloren. Wir haben unsere Heimat verlassen und sind in die Wüste gekommen. Daher lassen wir uns erst recht nicht erneut vertreiben. Falls wir Şehba irgendwann den Rücken kehren sollten, dann nur, um zurück nach Efrîn zu gehen. Bis zur Befreiung von Efrîn bleiben wir hier.“
Diesen Mut und den Überlebenswillen, die Stärke und Entschlossenheit, die die Vertriebenen jeden Tag aufbringen müssen, gilt es zu würdigen.
Bis zu fünf Millionen Dom, deren Wurzeln in Indien liegen, leben nach Angaben der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) verstreut in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens. Und doch sind sie eine weitgehend unbekannte ethnische Minderheit. Denn wie Roma und Sinti in Europa wurden und werden Dom auch in den Ländern von Nah- und Mittelost, in denen sie seit Jahrhunderten leben, systematisch diskriminiert und von der öffentlichen Sphäre ausgeschlossen. In Syrien etwa, wo vor Ausbruch des Krieges verschiedenen Schätzungen nach etwa 100.000 bis 250.000 Dom lebten, stellt antiziganistische Marginalisierung und Diskriminierung unter dem Regime und dessen Ideologie des arabischen Nationalismus ein großes strukturelles wie soziales Problem dar. Sie werden in allen Bereichen des Lebens – Gesundheitsversorgung, Bildung, Arbeits- und Wohnungsmarkt – diskriminiert, leben ausgegrenzt ohne Rechte und werden gesellschaftlich in die Armut gedrängt – ein Bürgerkrieg im Verborgenen. Durch Krieg und Besatzung im Land sind Dom zusätzlich Gewalt, Flucht und Vertreibung ausgesetzt und damit von doppelter Diskriminierung betroffen.
Die Dom sprechen neben der in der jeweiligen Region vorherrschenden Sprache das „Domari“, das der Sprache der europäischen Roma, dem Romani, ähnelt. Statt traditionell christlich, wie viele Roma Ost- und Westeuropas, sind die Dom des Orients heute fast ausschließlich Muslime. Doch leben sie kein sehr striktes religiöses Leben. Im Gebiet des heutigen Syrien gab es Dom schon vor Zeiten des Osmanischen Reiches (ca. 1300 bis 1922), ihren eigenen Mythen nach sollen sie sogar schon vor tausend Jahren im Land zwischen Euphrat und Tigris angekommen sein.
2012 wurde die Zahl der in Syrien verbliebenen Dom, deren größte Gemeinden in Aleppo, Damaskus, Saraqib, Latakia, al-Hamah und Homs waren, von der syrischen Zeitung Kassioun auf über 60.000 geschätzt. Die meisten Angehörigen dieser Gemeinschaft, die vor dem Krieg geflohen sind, leben heute in der Türkei.