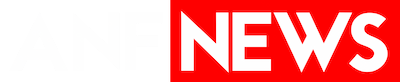Rund um den Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März schreiben sich auch viele Behörden und Stadtverwaltungen „Antirassismus“ auf ihre Fahnen. Zum Beispiel kommen die „Nürnberger Wochen gegen Rassismus vom 15. bis 28. März 2021“ mit mehr als 30 geplanten Aktionen und Projekten durchaus ambitioniert daher. Unter dem Motto „Solidarität. Grenzenlos“ kann man zum Beispiel gegen den Rassismus ansingen oder eine rassismuskritische Ausstellung im Spielzeugmuseum besuchen. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König forderte auf, die Veranstaltungen „mit Leben zu erfüllen, sich auszutauschen und zu vernetzen.“
Die Initiative „Seebrücke“ und die Interventionistische Linke (iL) zögerten nicht lange und organisierten eine Kundgebung vor dem Rathaus, die es auch ins offizielle Programm geschafft hat. Die Organisatoren fragten, wie es bestellt ist um „grenzenlose Solidarität“ in der selbsternannten „Stadt der Menschenrechte“. Bei dieser Veranstaltung soll es gerade nicht um antirassistische Lippenbekenntnisse gehen. Vielmehr kommen per offenem Mikrofon Betroffene zu Wort und wurden gebeten, ihre Rassismus-Erfahrungen mit der Nürnberger Ausländerbehörde oder der Polizei zu schildern.
Im letzten Dezember erregte die Abschiebung der kranken Mimi T. nach Äthiopien großes Aufsehen. Olaf Kuch (CSU), Stadtrechtsdirektor und ehemaliger Chef der Nürnberger Ausländerbehörde, sah keine gesundheitlichen Abschiebehindernisse und ignorierte ein medizinisches Gutachten, nach dem die junge Frau aufgrund ihrer psychischen Verfassung und körperlichen Schwäche eine Abschiebung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überleben würde. Die Nürnbergerin übermittelte eine Audiobotschaft, in der sie ihre verzweifelte Lage in einem Land beschreibt, in dem sie niemanden kennt.
Danach berichteten zwei Frauen sehr emotional von ihren traumatischen Erlebnissen in Sammelunterkünften und mit den Ausländerbehörden.
Fälle von Banu Büyükavci und Murat Akgül angesprochen
Der Fall der Nürnberger Ärztin Banu Büyükavci wurde angesprochen. Ihr entzog die Nürnberger Ausländerbehörde nach der noch nicht rechtskräftigen Verurteilung im TKP/ML-Prozess die Niederlassungserlaubnis und leitete ein Ausweisungsverfahren ein. Seit letztem Dezember kämpft das Soli-Bündnis „Banu Bleibt“ um ein Bleiberecht für die Ärztin.
Zur Sprache kam auch der Fall des Kurden Murat Akgül aus Nürnberg, der im Sommer 2018 eine YPG-Fahne zeigte - damals in Bayern noch strafbar nach dem Vereinsgesetz. Es folgte ein „Sicherheitsgespräch“ und im Februar 2019 erhielt Akgül Post von der Ausländerbehörde: Entzug der Niederlassungserlaubnis, Meldeauflagen, Ausweisungsverfügung. Schließlich wurde er in die Türkei abgeschoben. Nur durch einen Zufall entkam er und machte sich zurück auf den Weg nach Deutschland. Nach der Wiedereinreise kam er in erst Untersuchungshaft, danach in ein Ankerzentrum, wo er seit 2019 festsitzt und deshalb auch nicht heute persönlich erscheinen konnte. Aktuell wartet er auf ein Verfahren wegen „illegaler Einreise“ in die Stadt, die ihm nach 20 Jahren längst zur Heimat wurde.
„Gerade politisch aktive Kurd*innen gelten bei den deutschen Sicherheitsorganen oft als ‚terrorismus-verdächtig‘, werden dann mit Schikanen durch die Ausländerbehörden drangsaliert und müssen mit aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Wer sich zur kurdischen Identität bekennt, lebt mit der Gefahr, kriminalisiert zu werden. Dafür sorgt seit Jahrzehnten die systematische Stigmatisierung infolge des Verbots der Arbeiterpartei Kurdistans. Mit dem Totschlag-Argument ‚Sicherheitsrisiko‘ haben deutsche Behörden nahezu freie Hand, das Leben von politisch missliebigen Migrant*innen durch die Keulen des Aufenthaltsrechts zu zerstören, wie wir am Beispiel von Banu Büyükavci oder Murat Akgül sehen“, so eine Sprecherin des Unterstützerkreises.
Abschiebeflughafen, Polizeirazzien in Sammelunterkünften, Stigmatisierung durch Presse
Während der Kundgebung kamen noch weitere Punkte zur Sprache. Die Pressesprecherin der Seebrücke Carina Meyer fasst zusammen, dass „rassistisches Denken und Handeln [...] in unserer Gesellschaft nach wie vor fest verankert [ist]. Kein Individuum, keine Behörde, keine Institution und schon gar nicht die Stadt Nürnberg sind frei davon.“
Als Beispiel wurde die klammheimliche Entscheidung der Stadtverwaltung erwähnt. Sie gab hinter dem Rücken des Stadtrats grünes Licht für die Umwandlung des Albrecht-Dürer-Airports in einen Abschiebeflughafen. Wie passt dies zu einer „Stadt der Menschenrechte?“, fragte die Seebrücke.
Auch die anlasslosen Polizeirazzien in Sammelunterkünften für Geflüchtete wurden kritisiert. Nie werde die Verhältnismäßigkeit hinterfragt, wenn schwerbewaffnete Polizeieinheiten Unterkünfte stürmen. Die begleitende Presseberichterstattung trage dann regelmäßig dazu bei, geflüchtete Menschen zu stigmatisieren, und bereite den Boden für rechte Hetze und Gewalt.
Seebrücke vermisst „rassismuskritische Selbstreflexion“
Die Seebrücke Nürnberg vermisst vor allem eine „rassismuskritische Selbstreflexion“ der Stadtoffiziellen: „Die Nürnberger Ausländerbehörde ist […] bundesweit dafür bekannt, äußerst restriktiv und unmenschlich gegenüber Geflüchteten und Migrant*innen zu agieren. Regelmäßig berichten Menschen von Rassismuserfahrungen, tendenziöser und unprofessioneller Beratung sowie Angst, diese Behörde alleine zu betreten. Wenn Oberbürgermeister Markus König Nürnberg antirassistischer machen will, dann sollte er am besten bei der Stadt Nürnberg selbst anfangen. Es ist zynisch, sich einerseits mit einem bunten Programm zu brüsten und gleichzeitig hilfesuchende und kranke Menschen in bitterste Not abzuschieben. Wir wollen laut werden und der Stadt Nürnberg einen kritischen Spiegel vorhalten.“
Zum Abschluss der Kundgebung zeigten die Aktivist*innen noch die Gesichter des rassistischen Mordanschlags von Hanau und erinnerten an die Opfer des NSU und daran, dass Rassismus ein gesellschaftliches Problem ist, nicht nur, aber auch in Nürnberg.