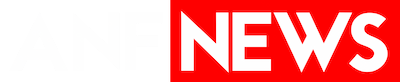Am Montag fand zum zweiten Mal das feministische Café der Kampagne „Gemeinsam Kämpfen“ in Hamburg statt. Anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen waren Frauen aus lateinamerikanischen Ländern zu Besuch, die von ihren Kämpfen aus Peru, Mexiko, Kolumbien und Chile berichteten.
Zu Beginn wurde ein Brief von einer spanischen Freundin vorgelesen, die den westlichen Feminismus dafür kritisiert, die besondere Situation der Frauen in Lateinamerika nicht zu berücksichtigen und davon auszugehen, dass ihre Kämpfe und Forderungen die gleichen seien wie die der westlichen Frauen, was den westlichen Feminismus zu einer kolonialen Spiegelung mache. Europäische Feminismen hätten eine Vormachtstellung auf internationaler Ebene. Sie würden dazu neigen, über den Feminismus im Singular zu sprechen und die besonderen Situationen von Frauen in anderen Orten der Welt vergessen. Da es ohne Zusammenarbeit mit anderen unterdrückten Gruppen keinen Feminismus gäbe, appellierte sie an die europäischen weißen Frauen ihr Privileg als solches zu nutzen, damit die Stimmen anderer Frauen gehört und anerkannt werden können, die ebenso gültig sind wie ihre.
Wir können auf dieser Erde im Paradies leben und das schaffen wir
Die großen Unterschieden bezüglich der Frauenthemen in Lateinamerika und Europa wurden auch von der peruanischen Freundin Ada angesprochen, wobei sie betonte, dass die Unterschiede nicht qualitativ im Sinne von besser oder schlechter seien, sondern das sich die Unterschiede aus der unterschiedlichen Geschichte des Patriarchats ergeben, welches sozusagen mit der Kolonialisierung importiert wurde.
Die Geschichte der indigenen Bevölkerung begann aber nicht erst mit der Kolonialisierung. Die Menschen haben vorher in Harmonie gelebt, die Erde hat sich selbst gehört und wurde als lebende Person betrachtet, die auch eine Energie hat. In dieser Weltanschauung existiert kein Bewusstsein für Kampf und Töten. Diese Überzeugung hat sich noch bis heute im Widerstand gehalten. Ziel war nie das Töten des Feindes, sondern dass das Leben respektiert wird. Sie sagte, dass die heutige Gesellschaft mit unserem Bewusstsein geändert werden könne, nicht aber mit Waffen.
Aus Vereinigung entsteht große Kraft
In Mexiko habe das Verschwinden von Menschen zu einer in erster Linie von Frauen organisierten Suche geführt. Besonders in bestimmten Teilen Mexikos, wie der Grenze zu den USA, wurden viele Menschen verschleppt, gefoltert und getötet. Viele geheime Gräber wurden schon gefunden. Da nicht nur Menschen aus Mexiko, sondern aus verschiedenen Ländern auf dem Weg Richtung USA verschwinden, entstand eine grenzübergreifende Solidarität, vereint in dem Schmerz über den Verlust.
Wegen der vielen Feminzide seien immer mehr Männer mit organisiert. Sie seien Feministen geworden, da sie nicht wollten, dass das mit ihrer Schwester, Tochter, Freundin, Mutter passiert. Der Feminismus in Mexiko werde nicht als von den Männern getrennt betrachtet. Die Menschen dort seien sich bewusst, dass es ihre Rolle als Mensch ist für die Menschenrechte zu kämpfen und auf die Straße zu gehen, auch wenn viele Aktivist*innen getötet werden.
Maria erzählte auch von den Frauen ohne Furcht – unterschiedlichste Frauen, die gemeinsam haben, dass sie sich politisch äußern, die zwar Angst haben, aber die sich stark fühlen, weil sie zusammen sind.
Die Kampagne metoo nannte sie als westliches Beispiel dafür, wie aus Vereinigung große Kraft entstehen kann, wenn eine ihre Stimme erhebt und andere dann auch ihre Stimmen erheben. Es vereinige Männer und Frauen im Bewusstsein, dass es unsere Rolle als Mensch ist für unsere Rechte einzutreten.
Den dortigen Kämpfen Aufmerksamkeit schenken
In Kolumbien habe der Friedensvertrag zwischen der Regierung und der FARC keinen Frieden, sondern einen Machtgewinn der Paramillitärs und verstärkten Landraub gebracht. Auf den ehemaligen Gebieten der FARC seien nun entweder Paramillitärs oder transnationale Unternehmen wie zum Beispiel Nestlé. Die Lebensbedingungen der indigenen Bevölkerung werden zerstört, damit beispielsweise Vattenfall dort Kohle fördern könne.
In Kolumbien gibt es tausende politische Gefangene. Blanca erzählte von den grausamen Bedingungen im Gefängnis, wie zum Beispiel, dass es dort keine medizinische Versorgung gäbe und Wasserentzug als Foltermittel eingesetzt werde.
Dass wir in Deutschland kaum bis gar nichts von der Situation in Kolumbien mitbekommen – wie zum Beispiel den seit zwei Monaten andauernden Protesten von Studierenden – liege zum einen an den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Kolumbien. Da zum Beispiel der weiße Zucker, den viele von uns hier täglich konsumieren, aus Kolumbien stammt, bestehe kein Interesse daran, dass die dortigen Zustände hier öffentlich werden.
Zum anderen wurde die Kritik geäußert, das linke Kräfte sich immer nur auf ein Gebiet fokussieren würden. Dieses sei derzeit Rojava, was auch gut und wichtig ist. Dennoch sollte auch anderen Kämpfen, wie eben in Kolumbien und ganz Lateinamerika, mehr Beachtung geschenkt werden. Deutschsprachige Nachrichten zu den politischen und gesellschaftlichen Prozessen in Lateinamerika findet man auf www.amerika21.de.
Sie erzählte auch von der strukturellen Gewalt, die die Frauen dort erleben. Beispielsweise habe die Kirche in Lateinamerika große Macht, weswegen Frauen mit unehelichen Kindern als Freiwild betrachtet würden. Auch die Verweigerung des Schulbesuchs von jungen Frauen stellt eine starke Art von Missbrauch und Gewalt dar, da das ICH zerstört wird, da sie sich nicht weiterentwickeln können.
Kampf auf unterschiedlichen Ebenen – parlamentarisch und radikal
In Chile kann zwischen einer Frauenpolitik, das heißt einer sozialen Politik, an der Parteien, Initiativen, Vereine aber auch feministisch autonome Gruppen beteiligt sind, und einer feministischen Politik, an der nur feministisch autonome Gruppen beteiligt sind, unterschieden werden.
Auf parlamentarischer Ebene wurde 2015 ein großer Erfolg erzielt, da ein Gesetzesentwurf gegen sexuelle Belästigung ratifiziert wurde. Bis dahin wurde sexuelle Belästigung als natürlich angesehen, berichtet Romina. Das Mitte-Rechts-Bündnis habe lange Zeit dagegen argumentiert und sexuelle Belästigung als Kompliment bezeichnet, statt es als Problem zu thematisieren. Auch die Politik des Frauenausschusses mit Genderperspektive wird mit einem Spiel auf Zeit blockiert.
Von der feministischen Politik werden große Demonstrationen organisiert, bei denen einzelne Vertreter*innen der Parteien zwar mitlaufen, allerdings nur für die eigene Partei Werbung machen. Die feministisch autonomen Gruppen hingegen gehen radikaler vor und laufen oft Oberkörper-frei mit feministischen Zeichen bemalt bei Demonstrationen mit.
Die autonomen Strukturen fordern mehr und kritisieren die großen Parteien dafür, dass sie nicht genug fordern.
Nicht der eine Feminismus, sondern viele Feminismen
In der anschließenden Diskussion wurde noch einmal die anfängliche Kritik aufgegriffen, dass europäische Frauen ein Problem damit hätten zu verstehen, was im Rest der Welt – wie zum Beispiel Lateinamerika, Kurdistan – passiert. Es kam die Frage auf, wie sich Frauen in Hamburg organisieren sollen und der Vorschlag eines feministischen Parlaments, in dem alle Frauen aus der ganzen Welt vertreten sind.
Dieser Vorschlag führte zu einer Diskussion, in der es in erster Linie um die Frage ging, ob feministische Kämpfe mit Männern oder ohne Männer geführt werden sollten. Da jede Bewegung aber ihre eigene Geschichte hat, je nach Ort unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat und unterschiedliche Kämpfe führt, gibt es nicht den einen Feminismus.
„Ein feministisches Parlament sollte nicht an der Frage, ob mit Männern oder ohne gekämpft wird, scheitern. Es sollte ein Ort sein, an dem wir uns stärken, an dem jede ihre Geschichte und ihr Wissen einbringen kann. Es sollte ein Ort sein, an dem wir Pläne schmieden für ein gemeinsames Ziel, auch wenn wir unterschiedliche Wege zu diesem Ziel gehen", so das Fazit in der Diskussion.