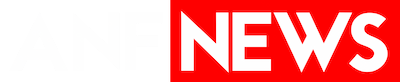Vor dem Hamburger Oberlandesgericht ist der am Donnerstag eröffnete Prozess gegen den kurdischen Aktivisten Mustafa Çelik fortgesetzt worden. Dem 43-Jährigen wird Mitgliedschaft in der PKK vorgeworfen.
Die vorsitzende Richterin Taeubner erklärte zu Verhandlungsbeginn, dass die schriftliche Ausführung noch nicht vorliegt, die ärztliche Begutachtung vom Vortag jedoch eine volle Verhandlungsfähigkeit des unter einer chronischen Erkrankung und ständigen Schmerzen leidenden Angeklagten ergeben habe.
„Man muss die Geschichte kennen“
Anschließend wollte die Richterin den Angeklagten „kennenlernen“. Mustafa Çelik wies auf seine Angaben aus seinem vorherigen 129a/b-Prozess vor dem OLG Celle hin, in dem er im August 2016 zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Da das dem Gericht nicht ausreichend war, erklärte Çelik, dass er Angehöriger eines kolonialisierten Volkes sei, das seit Jahrhunderten einen Genozid und Massaker erlebe: „Ich glaube, dass das für Sie schwer zu verstehen ist. Ein Farbiger aus Südafrika kann mich verstehen, ein Azteke oder Maya aus Südamerika kann mich verstehen, aber für Sie ist es schwierig. Mustafa Çelik ist nur ein Blatt an einem Baum, man muss die Geschichte des Baumes kennen, um mich zu verstehen.“
Von den Sumerern zur Jineoloji
Der Angeklagte fuhr fort mit einer ausführlichen Darlegung der kurdischen Geschichte beginnend bei den Sumerern über die Geschichte von Enkidu und Inanna aus dem Gilgamesch-Epos und die Versklavung der Frau bis zu der von der modernen kurdischen Frauenbewegung praktizierten Frauenwissenschaft Jineoloji. Nach etwa zwanzig Minuten versuchte die Richterin die Ausführungen abzukürzen und fragte, wie es dem kurdischen Volk denn 1977 in Palu, dem Geburtsort des Angeklagten in der nordkurdischen Provinz Xarpêt (türk. Elazığ), gegangen sei. Daraufhin erwiderte Mustafa Çelik, um das zu verstehen, müsse man die Vorgeschichte kennen und zum Beispiel wissen, was seine Großmutter erlebt hat. Er berichtete vom Şêx-Seîd-Aufstand, dem Dersim-Massaker und den Abkommen von Syke-Picot im Jahr 1916 und Lausanne 1923 und erklärte: „Das alles ist passiert, bevor ich zur Welt gekommen bin. Die Kurden sind dazu gebracht worden, sich ihrer Existenz zu schämen. Ihre Kultur und Sprache sind verboten worden.“
„Niemand kennt mich als Mustafa“
An diesem Punkt wandte sich der Angeklagte an Oberstaatsanwalt Schakau und monierte, dass in der Anklageschrift „Ahmet“ als Codename aufgeführt ist. Sein wirklicher Name laute „Amed“. Weil dieser kurdische Name verboten sei, habe er den offiziellen Namen Mustafa bekommen, aber er sei in der Familie und im Bekanntenkreis niemals so genannt worden: „Wenn auf der Straße jemand Mustafa ruft, würde ich mich gar nicht umdrehen. Niemand kennt mich als Mustafa!“
Seelisch nie in Deutschland angekommen
Weiter führte er aus, dass er Türkisch erst unter Schlägen in der Schule zwangsläufig gelernt habe. Die Unterdrückung habe nach dem Militärputsch 1980 in der Türkei eine noch viel systematischere Dimension angenommen. An die Richterin gewandt, sagte er: „Sie fragen nach mir? Ich habe doch Glück gehabt! Ich bin nur geschlagen worden, andere Kinder im Dorf sind von Soldaten getötet worden.“ Auch sein Vater sei festgenommen und gefoltert worden. Mit 15 Jahren sei er zu Verwandten nach Deutschland geschickt worden, weil er ansonsten im Gefängnis gelandet wäre: „Ich wollte hier nicht leben, ich bin seelisch nie in Deutschland angekommen.“
„Amed hat sich für die Berge entschieden“
1996 sei er zunächst zu Abdullah Öcalan an die PKK-Akademie in Syrien und nach zehn oder elf Monaten in die Berge zur Guerilla gegangen. „In dieser Zeit sind in Kurdistan 4800 Dörfer niedergebrannt worden, Tausende Menschen sind extralegalen Hinrichtungen zum Opfer gefallen. Man musste damals in Deutschland eine Entscheidung treffen: Man kann studieren, eine Familie gründen, arbeiten, Geschäfte machen. Aber gleichzeitig war für die Kurden erstmalig die Möglichkeit entstanden, selbstbestimmt zu leben. Es konnte dafür gekämpft werden, dass Frauen nicht mehr von Soldaten vergewaltigt und Dörfer nicht mehr zerstört werden. Amed hat sich für die Berge entschieden. Und ich würde mich immer wieder so entscheiden. Der Genozid am kurdischen Volk geht ja immer noch weiter.“ Drei Jahre lang habe er in den kurdischen Bergen gegen die türkische Armee gekämpft, in dieser Zeit wurde er sieben Mal verwundet. Im August 1999 wurde die Guerilla aus dem türkischen Staatsgebiet abgezogen.
Unerträgliche Schmerzen
Zu seinem Gesundheitszustand führte Çelik aus, dass er seit 2001 jeden Tag Schmerzen hat. Er erkrankte an Kimura, einem sehr seltenen Krankheitsbild. Seit 2008 sei diese nicht mehr als tödlich klassifiziert worden und habe sich chronifiziert. Nach seiner letzten Haftentlassung im Jahr 2018 seien die Schmerzen stärker geworden, er wurde sieben Monate lang mit Kortison behandelt. Die Schmerzen strahlen vor allem in Ohren, Augen, Mund, Zähne und Rachen aus, seit wenigen Wochen habe er Schwellungen an Handflächen und Fußsohlen und die Schmerzen seien unerträglich.
Zu seinen Haftbedingungen gab Çelik an, dass er 23 Stunden am Tag in der Sicherheitsabteilung in seiner Zelle eingeschlossen und Schikanen ausgesetzt ist.
Fortsetzung am 9. Juli
Die Verhandlung wird am Donnerstag, dem 9. Juli, um elf Uhr mit der Zeugenaussage des medizinischen Sachverständigen fortgesetzt. Nach der Verhandlung am Folgetag, dem 10. Juli, findet eine dreiwöchige Pause bis zum 29. Juli statt.