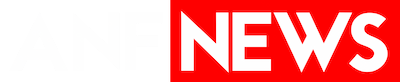Der kurdisch-ezidische Journalist Eyüp Burç erörterte im Gespräch mit ANF die weitreichenden Implikationen der Selbstauflösungsentscheidung der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und ordnete diese in den Kontext des sich wandelnden türkisch-kurdischen Konflikts ein. Burç beschrieb den Übergang von bewaffnetem Widerstand hin zu legaler und demokratischer Auseinandersetzung als historischen Wendepunkt – jedoch einen, der sowohl von Chancen als auch von strukturellen Widerständen geprägt sei. Besondere Aufmerksamkeit gilt laut dem Journalisten der Entwicklung zweier konkurrierender staatlicher Lösungsmodelle sowie den Macht- und Interessenlagen politischer Akteure wie Recep Tayyip Erdoğan (AKP) und Devlet Bahçeli (MHP). Burçs Analyse verdeutlicht, dass eine Lösung der kurdischen Frage untrennbar mit der Demokratisierung der Türkei verknüpft ist.
Welche Bedeutung haben die auf dem 12. Kongress der PKK gefassten Beschlüsse im Kontext der Debatten um eine politische Lösung der kurdischen Frage und den laufenden Prozess? Wie interpretieren Sie diese Entscheidungen?
Die von der PKK veröffentlichten Beschlüsse markieren eine neue Phase im Prozess. In der am 27. Februar veröffentlichten Erklärung (Abdullah Öcalans) mit dem Titel „Aufruf für Frieden und eine demokratische Gesellschaft“ wurde die Selbstauflösung der PKK sowie das Ende des bewaffneten Kampfes angekündigt. Dieser Entschluss wurde auf dem Kongress gefasst und somit ein zentrales Element der Erklärung umgesetzt.
Dies kennzeichnet einen neuen Abschnitt im kollektiven und politischen Subjektwerdungsprozess der Kurd:innen in ihrem Kampf für Freiheit und Rechte. Es bedeutet, dass wir historisch in eine neue Phase des seit der Gründung der Republik andauernden bewaffneten Konflikts eingetreten sind – eine Phase, die sich von den bisherigen durch eine klare Ausrichtung auf demokratische Auseinandersetzungsformen unterscheidet.
Beschreiben Sie diesen neuen Abschnitt als einen „juristisch und demokratisch geführten Prozess“?
Prozesse, die auf bewaffnete Auseinandersetzungen folgen, sind notwendigerweise durch legale und demokratische Mittel gekennzeichnet. Wie jede legitime Form des Widerstands ist auch der demokratische Kampf legitim. Der Kampf der Kurd:innen um Anerkennung als kollektives politisches Subjekt basiert auf Grundrechten und Freiheitsprinzipien und stellt einen gänzlich legalen Kampf dar. Es handelt sich hierbei um eine Bewegung mit moralischer Überlegenheit auf Seiten der Kurd:innen.
Mit der historischen Aufgabe der Waffen beginnt folglich ein Prozess demokratischen Widerstands. Dafür muss ein entsprechender juristischer Rahmen geschaffen werden. Dieser Transformationsprozess, der in eine dauerhafte Friedensordnung münden sollte, erfordert die Anerkennung rechtlicher Ansprüche und des Prinzips der Gerechtigkeit.
Obwohl die Mehrheit der politischen Akteur:innen in der Türkei diesen neuen Abschnitt unterstützt, gibt es kleinere Gruppen, die sich dagegenstellen – insbesondere unter Berufung auf Begriffe wie „Lausanne“ und „Genozid“, die in den Kongressbeschlüssen der PKK genannt werden. Was wollen diese Akteur:innen, die offenbar mit dem Waffenverzicht unzufrieden sind – wollen sie den Krieg fortsetzen?
Diese Gruppen repräsentieren ein Segment, das sich im Laufe der letzten hundert Jahre innerhalb des Staats- und Bürokratieapparats etabliert hat. Ich bin der Auffassung, dass in Teilen der militärischen und zivilen Bürokratie weiterhin Denkweisen vorherrschen, die auf Verleugnung und Vernichtung basieren. Darüber hinaus existiert ein durch die offizielle Staatsideologie geprägtes Milieu.
Diese Ideologie, die auf Homogenität beruht, wurde auch an den Universitäten reproduziert und in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen – von der Wissenschaft bis zu den Medien – verbreitet. Die daraus resultierenden Einwände mancher Individuen sind eine Konsequenz dieser langfristigen Indoktrination und daher bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar.
Andererseits gibt es Akteur:innen, die den Prozess bewusst manipulieren – diese handeln nicht aus Unwissenheit, sondern gezielt. Der Entschluss zur Selbstauflösung der PKK und der damit verbundene Wandel auf kurdischer Seite hat auch einen Wandel auf Seiten ihrer Gegenüber ausgelöst. Die daraus resultierenden Ängste führen zu propagandistischen Verzerrungen.
Wie würden Sie den aktuellen Prozess im Vergleich zu früheren Dialogphasen bewerten?
Der aktuelle Prozess hat seinen Ursprung bereits in den 1990er Jahren. Seitdem wurden in der Türkei immer wieder Alternativen zur bewaffneten Auseinandersetzung diskutiert. Der Dialog zwischen Turgut Özal und Abdullah Öcalan sowie diplomatische Bemühungen und Waffenstillstände haben diesen Prozess geprägt, wenn auch in Phasen unterbrochen. Im Rückblick lässt sich sagen, dass sich aus diesen Initiativen ein politischer Erfahrungsschatz gebildet hat. Dieser Fundus an Erfahrungen hat den heutigen Diskurs wesentlich mitgeprägt.
Worin unterscheidet sich der heutige Prozess von früheren Versuchen?
Frühere Prozesse waren von verschiedenen konjunkturellen, regionalen und globalen Faktoren beeinflusst. Seit 1993 hat sich die kurdische Bewegung jedoch einer paradigmatischen Veränderung unterzogen – weg vom Streben nach Unabhängigkeit, hin zu einem Fokus auf Koexistenz und einer gemeinsamen Heimat, mit dem Ziel, eine demokratische Lösung zu finden. Besonders die Bemühungen Abdullah Öcalans um eine friedliche Lösung haben seitdem an Intensität gewonnen.
Ich habe als Journalist und als Kurde verschiedene Phasen dieses Prozesses miterlebt. Infolge dieses Paradigmenwechsels hat sich die Bedeutung der Waffe von einem Instrument staatlicher Selbstverwirklichung zu einem Mittel der Anerkennung und Selbstverteidigung verschoben.
Die heutige Situation ist zudem durch die internationale, regionale und nationale Konjunktur geprägt. Die kurdische Bewegung verfolgt seit 1993 – unabhängig von äußeren Bedingungen – den Grundsatz, die kurdische Frage durch friedliche Mittel zu lösen. Der Staat hingegen wurde durch externe Faktoren zur Teilnahme an diesem Prozess bewegt. Heute zwingen sowohl die äußeren als auch die inneren Bedingungen beide Seiten zu einer Lösung. Diese objektive Notwendigkeit ist offensichtlich.
Ist also von einer Zwangsläufigkeit des Prozesses zu sprechen?
Objektiv betrachtet ja – aber die kurdische Bewegung hat diesen Weg auch subjektiv immer verfolgt. Der Staat hingegen sprach bisher lieber von einer „terrorfreien Türkei“ statt von einem friedlichen Prozess.
Warum wird der Prozess als „Projekt terrorfreie Türkei“ umschrieben?
Aus wissenschaftlicher Sicht handelt es sich hier um einen „Konfliktlösungsprozess“. Die Bezeichnung „terrorfreie Türkei“ ist in der Vergangenheit entstanden und hängt mit den Initiativen von Präsident Turgut Özal zusammen. Özal erkannte, dass die Sicherheits- und Vernichtungspolitik nicht zur Lösung führen würde, obwohl er gleichzeitig an deren Umsetzung beteiligt war – etwa durch die Einrichtung von Dorfschützerverbänden oder den Machenschaften des Militärnachrichtendienstes JITEM.
Özal sah ein, dass die Widerstände innerhalb des Staates überwunden werden mussten, und initiierte daher eine Zivilisierung des Geheimdienstes MIT, dessen Leiter bis dahin zumeist pensionierte Generäle waren. Er holte erstmals Zivilisten wie Emre Taner und später Şenkal Atasagun an die Spitze des MIT. Auch in der Armee versuchte er, bestehende Gepflogenheiten aufzubrechen – allerdings ohne durchschlagenden Erfolg.
Es existierten Berichte innerhalb der Armee, die darlegten, dass die kurdische Frage nicht durch sicherheitspolitische Mittel gelöst werden könne. Die Beseitigung Özals und Personen wie Eşref Bitlis kann als Eliminierung jener gelesen werden, die eine Lösung suchten. Doch das durch die Zivilisierung im MIT entstandene Modell blieb bestehen.
Mit dem Amtsantritt Erdoğans und der Annäherung an die EU wurde der Staat erneut zur Lösung gedrängt. Ich unterscheide zwei Modelle: eines, vertreten durch Emre Taner, das eine liberal-demokratische Perspektive auf den Konflikt verfolgt und offen die „kurdische Frage“ benennt; ein zweites, von Şenkal Atasagun vertretenes Modell, das lieber von einem „Terrorproblem“ spricht, um die Diskussion über ethnische Identitäten zu vermeiden.
In letzter Zeit kursiert der Name von Şenkal Atasagun hinter den Kulissen.
Eben. Das Lösungsmodell, das ich als liberal und demokratisch bezeichne und das von Emre Taner geprägt wurde, basierte auf der Idee, das Problem klar zu benennen: „Lasst es uns benennen, die kurdische Frage, und eine Lösung für diese Frage suchen.“ Es war ein Modell, das die Causa als solche definierte.
Das andere Modell, das von Şenkal Atasagun geprägt wurde, verfolgte einen anderen Ansatz: „Wenn wir dies eine kurdische Frage nennen, wird es eine entsprechende türkische Frage geben. Nennen wir es also nicht die kurdische Frage. Nennen wir es ein Terrorismusproblem und leiten wir einen Prozess zur Lösung des Terrorismus ein.“
Die Namensgebung ist somit nicht bloß semantisch, sondern Ausdruck grundverschiedener Herangehensweisen.
Aber prägt dieses Modell nicht auch die Art und Weise, wie das Thema von der Gesellschaft wahrgenommen wird? Ist es nicht diese „Terror“-Rhetorik, die in den Köpfen der Menschen heute für Verwirrung sorgt?
Gewiss. Diese Herangehensweise und begriffliche Unterscheidung steht für zwei unterschiedliche politische Haltungen, die je einer Partei und ihrer Strategie zur Machterlangung oder -sicherung entsprechen. Äußerungen wie „Ich würde selbst Schierlingsbecher trinken“ (Erdoğan) oder „Ich lege nicht nur meine Hand, sondern meinen ganzen Körper unter den Fels“ (Özel) sind populistische Phrasen. Wenn sie nur echtes Engagement widerspiegeln würden. Doch in Wahrheit kalkulieren diese Parteien, wie das Thema in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, welche Reaktion es hervorrufen könnte und wie sich bestimmte Maßnahmen auf den Machterhalt auswirken. Aus diesem Grund wurde die Aufgabe, keinen „türkischen Konflikt“ zu schaffen, der MHP als nationalistisch-konservativer Partei übertragen. So wurde nach 2004 ein duales Modell geformt: Während die AKP zunächst dem Emre-Taner-Modell folgte (Oslo-Prozess, Dolmabahçe), wurde später Şenkal Atasaguns Modell unter dem Begriff „Terrorfreies Türkei“ dominant – mit Devlet Bahçeli als Moderator und Atasagun als Berater.
Zwischen Erdoğan und Bahçeli scheint es dennoch Differenzen zu geben. Hat sich Ihrer Meinung nach Erdoğan de facto auf diesen Prozess eingelassen? Wie beeinflusst die weiterhin bestehende Demokratiedebatte in der Türkei den Prozess?
Eine Lösung der kurdischen Frage außerhalb demokratischer Wege ist undenkbar. Die Perspektiven Erdoğans und Bahçelis unterscheiden sich. Ich glaube nicht, dass Erdoğan eine Lösung grundsätzlich ablehnt, aber er priorisiert seinen Machterhalt. Er ist für eine Lösung nur dann offen, wenn sie ihm nützt. Aktuell erscheint ihm die Frage der eigenen politischen Zukunft bedeutsamer als das Überleben des Staates. Seine Haltung: „Wenn dieser Prozess meine Wiederwahl sichert, werde ich ihn unterstützen. Wenn nicht, werde ich ihn blockieren.“ Solche Schwankungen gab es bereits.
Hat sich diese Haltung Erdoğans bereits als riskant erwiesen?
Ja, wie die verlorene Wahl vom 7. Juni 2015 zeigt. Damals führte die politische Entspannung durch den Dialogprozess zu Wahleinbußen für Erdoğan. Er versuchte, das Land von der Bevormundung zu befreien, setzte jedoch seine eigene Bevormundung ein. Trotz seiner Versprechen nahmen Korruptionsfälle zu. Der Prozess wurde nicht durch Demokratisierung behindert, sondern durch Erdoğans eigenes Regierungsgebaren.
Doch ohne lokale Selbstverwaltung und eine starke kommunale Struktur lässt sich das Problem nicht lösen. Demokratisierung und Konfliktlösung im Kontext der kurdischen Frage sind untrennbar miteinander verbunden. Das Erdoğan-Regime muss sich den Konsequenzen einer Demokratisierung stellen.
Könnte die Weigerung, diese Konsequenzen zu akzeptieren, zu einem Bruch zwischen AKP und MHP führen?
Die Herangehensweise der MHP unterscheidet sich grundlegend von der der AKP. Während die MHP die Situation als Frage der Staatsräson deutet, sieht Erdoğan sie eher als Frage seines persönlichen Machterhalts. Sollte Erdoğan letzteren über den Staat stellen, ist ein Bruch mit der MHP möglich. Letztlich stellt sich die Frage: Soll das Überleben des Staates für fünf Jahre Erdoğan geopfert werden? Ich bin der Überzeugung, dass es in einer solchen Konstellation zu einem Bruch innerhalb der Allianz zwischen MHP und AKP kommen wird. Die MHP könnte dann eine alternative politische Position einnehmen.