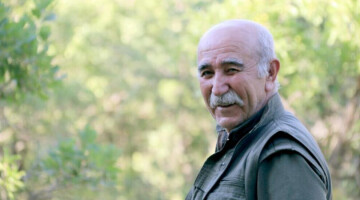Chance einer kurdisch-türkischen Verständigung
Vor knapp einer Woche verkündete die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Anschluss an ihren 12. Kongress die Beendigung ihres bewaffneten Kampfes und ihre organisatorische Selbstauflösung – eine Entscheidung, die in der politischen Geschichte der Türkei und der kurdischen Bewegung als Zäsur gewertet werden kann. Die Initiative geht auf den am 27. Februar veröffentlichten „Aufruf für Frieden und eine demokratische Gesellschaft“ von Abdullah Öcalan zurück. Diese Entwicklung löste in der Öffentlichkeit intensive Debatten über die zukünftige Ausrichtung der kurdischen Bewegung, mögliche staatliche Reaktionen und neue geopolitische Konstellationen aus.
Kein Abschluss, sondern Auftakt
Cengiz Çandar, Publizist und Journalist, ehemaliger Berater in früheren Dialogprozessen zwischen der kurdischen Bewegung und dem türkischen Staat und gegenwärtig Abgeordneter der DEM-Partei, ordnet die Entscheidung der PKK als einen Akt historischer Selbstbestimmung ein. Er hebt hervor, dass es sich um den ersten kurdischen Aufstand in der Geschichte der Republik handelt, der nicht durch staatliche Repression, sondern durch eine eigenständige Entscheidung der kurdischen Bewegung selbst beendet wurde.
„Die PKK war das Zentrum des bedeutendsten, längsten und umfassendsten kurdischen Aufstands der Moderne. Dass dieser nicht durch Niederlage, sondern durch freiwilligen Rückzug endet, schafft einen historischen Präzedenzfall“, so Çandar.
Er interpretiert die Entwicklung nicht als Abschluss, sondern als möglichen Auftakt zu einem friedlichen Transformationsprozess: Die Aufgabe des bewaffneten Kampfes sei kein Resultat von Verhandlungen, sondern ein einseitiger, strategischer Schritt, um einer politischen Lösung den Weg zu ebnen.
Neuer Raum für politische Aushandlung
Çandar betont, dass es in der gegenwärtigen Phase nicht um einen ausgehandelten „Deal“ gehe, sondern um das Öffnen eines politischen Möglichkeitsraums. Die Gespräche mit Abdullah Öcalan auf der Gefängnisinsel Imrali seien von Anfang an durch den türkischen Geheimdienstchef Ibrahim Kalın koordiniert und durch Präsident Recep Tayyip Erdoğan autorisiert worden – ein Indiz für die staatliche Ernsthaftigkeit der politischen Öffnung, die sich jedoch nicht in einer klassischen Verhandlungssituation vollzog. „Die Öffnung basiert nicht auf einem gegenseitigen Tauschgeschäft, sondern auf einer historischen Entscheidung der kurdischen Bewegung, bewaffneten Widerstand als Mittel politischer Artikulation zu beenden“, so Çandar.
Demokratisierung als nächste Etappe
Die Herausforderung bestehe nun darin, die sich bietende historische Chance politisch auszugestalten. Çandar sieht insbesondere die DEM-Partei in der Pflicht, sich programmatisch, strukturell und strategisch auf eine neue Rolle einzustellen. Eine Ära, in der politische Repräsentation und zivilgesellschaftliches Engagement die zentralen Mittel der kurdischen Bewegung darstellen, könne beginnen – mit unvorhersehbaren, aber potenziell transformatorischen Effekten. „Kürzlich unvorstellbare Dynamiken könnten sich entfalten. Das kurdische politische Spektrum wird sich weiter ausdifferenzieren und pluralisieren“, prognostiziert Çandar.
Regionale Implikationen und geopolitische Rahmung
Auch auf regionaler Ebene könnten sich tiefgreifende Veränderungen ergeben. Çandar verweist insbesondere auf die Lage in Syrien: Sollte sich die innenpolitische Stabilität in der Türkei nach dem 12. Mai verfestigen, sei eine konstruktive Rolle Ankaras im syrischen Kontext – etwa zwischen kurdischen Akteur:innen und arabischen Fraktionen – denkbar. In einem geopolitisch instabilen Umfeld, das durch den israelischen Gaza-Krieg und die Rückkehr Donald Trumps in die US-Politik zusätzlich verkompliziert werde, sei jedoch auch eine Destabilisierung nicht auszuschließen.
Risiken der Sabotage und das ungelöste sozialistische Erbe
Angesprochen auf die innerlinke Dimension verweist Çandar auf das geschwächte Erbe der sozialistischen Bewegung in der Türkei und international. Zwar begrüße die PKK in ihrer neuen Phase den Schulterschluss mit linken Akteur:innen, doch mangele es diesen aktuell an gesellschaftlicher Verankerung. Der Verlust an Organisationskraft seit den 1980er Jahren sowie die globale Krise linker Alternativen erschwerten es, neue Allianzen auf stabiler Grundlage zu etablieren.
Zudem verweist Çandar auf externe wie interne Sabotagepotenziale: Das historisch mögliche kurdisch-türkische Bündnis sei nicht im Interesse aller Akteur:innen – weder regional noch international. Umso wichtiger sei es, politisches Vertrauen aufzubauen, institutionelle Reformen anzugehen und Dialogfähigkeit nachhaltig zu stärken.
Cengiz Çandar kommt zu dem Schluss, dass sich für die Kurd:innen in der Türkei und der Region nun die historische Möglichkeit biete, durch demokratische Partizipation statt durch bewaffnete Konfrontation eine anerkannte und gleichberechtigte gesellschaftliche Stellung zu erlangen: „Zum ersten Mal besteht die reale Chance, dass Kurd:innen in der Türkei und im Nahen Osten eine aktiv gestaltende, anerkannte Rolle einnehmen können – nicht als Ausnahme, sondern als gleichberechtigter Bestandteil der politischen Ordnung.“
Die Aufgabe bewaffneter Mittel sei dabei nicht Kapitulation, sondern der strategische Wechsel hin zu einer langfristigen, auf Anerkennung und Gerechtigkeit gerichteten Politik. Ob daraus ein tragfähiger Friedensprozess entsteht, werde die politische Reife beider Seiten entscheiden.