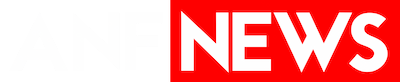Dr. Gisela Penteker ist Ärztin in Niedersachsen, seit Jahrzehnten in der Friedensbewegung und als Türkeibeauftragte der Deutschen Sektion der Organisation „Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.“ (IPPNW) und in der Geflüchtetenhilfe aktiv. In diesem Rahmen nimmt sie seit langer Zeit an Delegationsreisen ins kurdische Gebiet der Türkei, nach Nordsyrien/Rojava und in den Irak/Südkurdistan teil, um sich aktuell an Ort und Stelle ein Bild zu machen von der politischen und gesellschaftlichen Situation in dieser Region. „Dieser unsägliche Krieg der Türkei gegen die Kurden sowohl in der Türkei als auch in Syrien und dem Irak ist in mehrfacher Hinsicht völkerrechtswidrig, auch ohne den Einsatz von Chemiewaffen“, erklärte sie auf ANF-Nachfrage im Februar 2021 und klagte die „sogenannte westliche Wertegemeinschaft“ an, die sich durch ihre Komplizenschaft „mitschuldig“ mache.
Gerade diese letzte Aussage veranlasste den Rechtshilfefonds AZADÎ e.V. zu einem im März-Info erschienenen Gespräch mit der Ärztin:
Was hat Sie zu Ihren breit gefächerten politischen und humanitären Aktivitäten motiviert – mit einem inzwischen jahrzehntelangen Erfahrungshorizont?
Ich habe mich schon in der Schulzeit mit Fragen der internationalen Beziehungen und der Gerechtigkeit beschäftigt, anfangs mit Mission und Entwicklungszusammenarbeit, später zunehmend mit Friedensfragen mit dem Schwerpunkt Westafrika. Auf Reisen bin ich vielen Menschen und Kulturen und großer Offenheit und Gastfreundschaft begegnet und auch den prekären Bedingungen, unter denen viele Menschen im globalen Süden leben.
Gab es ein konkretes Ereignis, das zu Ihrem Engagement mit dem komplexen Thema des türkisch-kurdischen Konflikts geführt hat?
Es waren zwei parallele Erfahrungen, die mich motiviert haben. Zum einen lernte ich kurdische Familien in Deutschland kennen, denen die Abschiebung in die Türkei drohte. Wir, eine Anwältin, eine Psychologin und ich als Ärztin erstellten damals Gutachten über schwere Erkrankungen von Familienangehörigen und über die Behandlungsmöglichkeiten in der Türkei. In Niedersachsen gab es zu der Zeit noch kein psychosoziales Zentrum. Wir waren sozusagen einer der Vorläufer des heutigen Netzwerks für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen.
Zum zweiten war ich engagiert in einem Arbeitskreis Süd/Nord der IPPNW. Wir suchten ein Beispiel für einen bewaffneten Konflikt in erreichbarer Nähe, um zu verstehen, wie sich die Politik der EU, die Politik Deutschlands dort auswirken. Der türkisch-kurdische Konflikt bot sich an und wir fingen an, Kontakte in die Türkei zu knüpfen. Das Land und seine Menschen haben mich von der ersten Reise an fasziniert und ich bin nicht wieder davon los gekommen.
Sie kritisieren die „westliche Wertegemeinschaft“ und ihre Mitschuld an zahlreichen Konflikten auf dieser Welt. Zu dieser selbsterklärten Wertegemeinschaft gehört auch die BRD, die – eingebunden in die NATO-Strukturen – auch Waffen und Kriegsgerät in Konfliktregionen und an autoritäre Staatssysteme liefert, zum Beispiel an die Türkei. Welches Bild haben Sie sich auf Ihren Delegationsreisen in die kurdischen Gebiete über den Einsatz deutscher Waffen machen können?
Die Türkei hat nach der Wiedervereinigung viele der NVA-Waffen der DDR bekommen. Bei den ersten Reisen in die kurdischen Gebiete im Südosten waren besonders unsere männlichen Mitreisenden ständig auf der Suche nach den NVA-Panzern, die man an ihrem Außenspiegel erkennen konnte. Sie versuchten, gute Fotos davon zu machen, obwohl das natürlich verboten und nicht ungefährlich war. Wir waren naiv genug zu glauben, wenn wir beweisen könnten, dass diese Panzer entgegen der Vereinbarung in den kurdischen Gebieten gegen die Bevölkerung eingesetzt werden, würde sich an den Waffenlieferungen in die Türkei etwas ändern.
2014 war ich mit dem damaligen Bundestagsabgeordneten der Linkspartei, Jan van Aken, in Rojava, der hartnäckig nach Beweisen suchte und Beweise fand, dass NATO-Waffen vom sogenannten „Islamischen Staat“ benutzt wurden. Dass beim Einmarsch der Türkei in Efrîn/Nordsyrien deutsche Leopardpanzer im Einsatz waren, konnte jede und jeder im Fernsehen mitverfolgen.
Die enge Kooperation Deutschlands mit der Türkei hat eine sehr lange Tradition und findet auf vielen Ebenen statt. Dazu gehört als wichtiges Element die Kriminalisierung linker türkischer Organisationen und insbesondere der kurdischen Bewegung und ihrer Anhänger*innen, die bereits in den 1980er Jahren begann und mit dem PKK-Betätigungsverbot vom November 1993 fortgesetzt wurde. Wie bewerten Sie diese bis heute anhaltende und immer wieder verschärfte Repression gegen politisch aktive Kurd*innen und jenen, die sich mit ihnen solidarisieren?
Die Repression gegen kurdische Vereine und alle für die kurdische Sache in Deutschland aktiven Menschen halte ich für einen großen Fehler. Ich sehe keinen politischen Sinn darin, eine ganze Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes unter Generalverdacht zu stellen und damit auch ihre Integration oder besser Inklusion in unsere Gesellschaft zu torpedieren. Das PKK-Verbot und das Verbot von kurdischen Fahnen und Symbolen behindert eine sachliche Auseinandersetzung mit den berechtigten Forderungen der Kurden nach Anerkennung ihrer eigenen Kultur, Geschichte und Volkszugehörigkeit.
Die Wahrnehmung „der Kurden“ in unserer Gesellschaft ist dadurch verzerrt. Das Bild der Kurden als kriminelle Großfamilien, Drogendealer und Terroristen ist in der deutschen Bevölkerung weit verbreitet und hält sich hartnäckig, obwohl es inzwischen im öffentlichen Raum, in den Medien, der Politik, den Gewerkschaften und vielen anderen Bereichen gut ausgebildete und auch in unserer Gesellschaft engagierte Kurdinnen und Kurden gibt, die aber häufig dann nicht als Kurden wahrgenommen werden.
Die deutsche Gesellschaft erlebt die Kurden hier bei den großen Demonstrationen und Kulturfesten als eine fremde homogene Masse. Hier gelingt es bisher überhaupt nicht, zu vermitteln, dass es ihnen um die Freiheit und Würde aller Menschen geht. Wir müssen andere Formen finden, mehr Deutsche und oppositionelle Türken in die Aktionen mit einzubeziehen. Gerade jetzt, mit dem Verbot der HDP, der drittstärksten Partei in der Türkei und dem türkischen Ausstieg aus der Istanbul-Konvention sollten sich gemeinsame Themen finden und gemeinsamer Widerstand bilden. In einem Gespräch mit Vertreterinnen einer Frauenorganisation in Diyarbakir gestern hieß es: „Wenn die europäischen Regierungen sagen, sie seien besorgt über die Entwicklung in der Türkei, dann genügt das nicht. Gestern haben sie im Gespräch mit Ankara gesagt, sie seien sehr besorgt. Aber das genügt nicht.“
Haben Sie im Rahmen Ihrer Arbeit bei IPPNW, aber auch im Dialog-Kreis „Die Zeit ist reif für eine politische Lösung im Konflikt zwischen Türken und Kurden“, Gespräche mit Vertreter*innen politischer Parteien oder auf Regierungsebene führen und die Verbotspolitik thematisieren können? Was waren Ihre Erfahrungen?
IPPNW ist Mitglied der Kampagne für eine Aufhebung des PKK-Verbots. Über gelegentliche Presseerklärungen, die Unterstützung für in der Türkei inhaftierte Kolleg*innen und die jährlichen Berichte von unseren Delegationsreisen haben wir wenig Einfluss. Unsere Berichte werden zwar an die einschlägigen Politiker und Gremien verschickt, es gibt aber nur selten Rückmeldungen.
Der Dialogkreis ist nach dem Tod von Andreas Buro [Professor für Internationale Politik an der Goethe-Universität, Friedens- und Konfliktforscher, Mitglied von IPPNW, 2016 verstorben, Azadî] sehr geschrumpft. Wir schaffen es zur Zeit nur noch, Informationen über die Entwicklung in der Türkei und Kurdistan zu sammeln und zu verteilen.
Die am Anfang erhoffte Diskussion zwischen Kurden und Türken hier in Deutschland hat nie wirklich stattgefunden. Die Polarisierung ist hier eher noch stärker als in der Türkei. Vielleichtt kann in Köln, dem Sitz des Dialogkreises, ein neuer Anfang gelingen, da viele oppositionelle Türken seit 2016 ihre Heimat verlassen mussten und sich im Raum Köln angesiedelt haben.
AZADÎ hat seit seiner Gründung im Jahre 1996 gemeinsam mit anderen Organisationen, Verbänden und Einzelpersonen eine Reihe von Veranstaltungen initiiert, die sich mit der Kriminalisierung der kurdischen Bewegung und der Forderung nach Aufhebung des PKK-Verbots befasst haben. Gab/gibt es ähnliche Initiativen auch vonseiten der IPPNW und wenn ja, auf welche Resonanz sind diese gestoßen?
IPPNW hat sich an einigen dieser Veranstaltungen beteiligt und ist, wie oben schon erwähnt, Teil der Kampagne. Wir sind aber innerhalb unseres sehr diversen Vereins nur eine kleine Gruppe und müssen immer wieder neu um die Beteiligung an kurdischen Aktivitäten kämpfen. Wir werben bei jeder sich bietenden Gelegenheit im Verein für die von Abdullah Öcalan entwickelte konföderale gleichberechtigte, ökologische Demokratie, wie sie in Nordostsyrien und – soweit möglich – in Nordkurdistan versucht wird. Viele Menschen in Deutschland sind mit unserer Art der repräsentativen Demokratie und der neoliberalen Ordnung unzufrieden. Das kurdische Modell ist ihnen aber zu radikal und kommunistisch. Eine breite und offene Diskussion darüber wäre sicher wünschenswert. Eine zunehmende Polarisierung auch hier bei uns verhindert das aber weitgehend.
Vor dem Hintergrund der massiven ökonomischen und geostrategischen Interessen Deutschlands im Hinblick auf die Türkei scheint keine Änderung des harten Repressionskurses gegenüber der kurdischen Bewegung in Sicht. Die Verteidiger*innen in den §129b-Verfahren kämpfen juristisch für einen Perspektivwechsel. Was glauben Sie, müsste geschehen, um auf der politischen Ebene einen Meinungswandel zu erreichen?
Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir haben ein Super-Wahljahr und damit neue Chancen. Es gibt ja Parteien, die der kurdischen Frage und den Veränderungen der Gesellschaft im Sinne einer solidarischen, sozialen, partizipativen und ökologischen Demokratie offen und positiv gegenüber stehen und sich auch gegen Waffenhandel und militärische Interventionen und für eine ehrliche Menschenrechtspolitik aussprechen. Ob sie dann stark genug vertreten sind, um sich in Koalitionen zu behaupten, liegt auch ein bisschen an uns. Wir können zumindest daran arbeiten, dass das Thema Eingang in die Wahlprogramme findet.
Wir bedanken uns für das Gespräch.