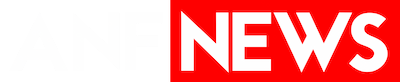Der Miştenûr ist ein etwa 50 Meter hoher Hügel südöstlich von Kobanê. Er liegt an strategischer Stelle und überblickt die ganze Stadt. Seine Einnahme würde einen ungehinderten Einfall in Kobanê ermöglichen. Genau das geschah im Herbst 2014, beim großen Kampf um Kobanê, als die bis dahin für die meisten Menschen unbedeutende Stadt im Norden Syriens zum Symbol des Ringens zwischen Gut und Böse wurde. Miştenûr ist der Ort, an dem Arîn Mîrkan, eine junge YPJ-Kommandantin aus Efrîn, am 5. Oktober 2014 einen Versammlungspunkt des IS überrannte und inmitten der Dschihadisten die Handgranaten in ihrem Brotsack zündete. Ihr Widerstand versinnbildlichte den Durchhaltewillen der Verteidiger*innen Kobanês und machte dem Westen, der sie entweder als „Selbstmordattentäterin” feierte, oder dieser „Aufopferungsaktion”, die den Kampf schlussendlich zu Gunsten der YPG und YPJ wendete, hilf- und verständnislos gegenüberstand, auf drastische Weise deutlich, um welchen Preis es für Rojava ging. Und er markierte den Wendepunkt in der „Schlacht” gegen den IS. In 134 Tagen Widerstand für jedes Viertel, jede Gasse und jedes Haus in Kobanê brachten die YPG und YPJ der „größten Terrormiliz des 21. Jahrhunderts” die erste, aber vor allem entscheidende Niederlage bei.
„Immer müssen Millionen müßige Weltstunden verrinnen, ehe eine wahrhaft historische, eine Sternstunde der Menschheit in Erscheinung tritt.“
In seinem Weltbestseller „Sternstunden der Menschheit” versammelt der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig vierzehn Miniaturen, die von historischen Begebenheiten erzählen, deren Auswirkungen die Geschichte der Menschheit verändert haben. Der Bogen spannt sich von der römischen Diktatur über die Schlacht bei Waterloo bis hin zum gescheiterten Versailler Frieden. Im Mittelpunkt der Erzählungen steht die seelische Verfassung der ausschließlich männlichen und vor allem europäischstämmigen Akteure. Vermutlich wäre es müßig zu spekulieren, ob Zweig auch heute noch das heroische Geschichtsbild im Sinne des Historikers Heinrich von Treitschke - „Männer machen die Geschichte“ - vertreten würde. Doch beim Blick auf die Revolution von Rojava kommt man nicht drum herum, Zweigs Annahme, dass nicht kollektive Kräfte, sondern stets große Charaktere das Weltgeschehen bewegten, zu belächeln.
Ağırnaslı bei der „Karawane der Gefallenen“
Als der seit Ende September mit Panzern, schweren Geschützen und einem unerschöpflichen Reservoir an Truppennachschub aus der Türkei angegriffene Miştenûr am 5. Oktober 2014 für eine Zeitlang in die Hände des IS fiel, war auch Suphi Nejat Ağırnaslı Teil des kollektiven Widerstands von Kobanê. Ob er bereits an diesem Tag starb oder erst später, ist nicht eindeutig geklärt. In jedem Fall geriet er am Todestag von Arîn Mîrkan in IS-Gefangenschaft. Am 7. Oktober gaben die YPG, denen er angehörte, bekannt, dass sich Ağırnaslı der „Karawane der Gefallenen“ angeschlossen hat. Erst nach der Befreiung des Miştenûr irgendwann im darauffolgenden Januar konnte die Suche nach seinem Leichnam aufgenommen werden. Es sollten noch elf Monate vergehen, bis man fündig wurde.
Kurden beobachten aus dem gegenüberliegenden Riha (türk. Urfa) die Kämpfe am Miştenûr
Suphi Nejat Ağırnaslı wurde 1984 in Söke, einer Stadt an der Ägäisküste, in eine linke Familie geboren. Seine polizeilich gesuchte Mutter Nuran, die nach den Militärputschen 1971 und 1980 eine Weile im Gefängnis saß, brachte ihn abends auf die Welt, am nächsten Morgen flüchtete sie mit dem Neugeborenen auf dem Arm aus dem Krankenhaus. Suphis Großvater Niyazi Ağırnaslı war in den 1960er Jahren Senator der Arbeiterpartei TIP und gehörte 1971 zu den Rechtsanwälten der revolutionären Führer der 68er-Bewegung Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan und Hüseyin Inan. Benannt wurde Suphi Nejat nach zwei Gründern der historischen Kommunistischen Partei der Türkei (TKP), Mustafa Suphi und Ethem Nejat, die 1921 gemeinsam mit allen restlichen dreizehn Mitgliedern des TKP-Zentralkomitees in Trabzon von Kemalisten umgebracht wurden.
Ende der achtziger Jahre verließen Suphi Nejat und seine Familie aus politischen Gründen die Türkei. Nach einem einjährigen Aufenthalt in Griechenland ließen sie sich 1990 in Duisburg nieder. Dort besuchten Suphi Nejat und seine Schwester zunächst eine Vorschule für „Migrantenkinder“, bevor sie auf eine Regelschule kamen. Das soziale Umfeld der Eltern, die weiterhin politisch aktiv waren und in linken Vereinen ein- und ausgingen, prägte die beiden. Elif Berivan fiel auf, weil sie einmal auf die Frage, wer denn ihr Idol sei, mit dem Namen Rosa Luxemburgs antwortete. Später legten Lehrer den Eltern nahe, Suphi Nejat doch nicht in Vereine mitzunehmen. Der Junge male Hammer und Sichel und behaupte, es sei die Fahne seiner Heimat. Das bekannteste Symbol des Marxismus-Leninismus wurde nach der russischen Oktoberrevolution entwickelt und steht für die Einheit von Arbeiter- (Hammer) und Bauernklasse (Sichel).
Als Grundschüler in Duisburg und als Kämpfer in Kobanê
„Niemals vergessen, niemals vergeben, niemals aufgeben“
Sein Abitur machte Suphi Nejat am Duisburger Clauberg-Gymnasium, zum Studium ging er zurück in die Türkei. Nach einem ersten Anlauf an der Istanbuler Marmara-Universität, wo er sich im Studiengang englischsprachige Soziologie eingeschrieben hatte, wechselte er an die Bosporus-Universität. Das Thema seiner Masterarbeit waren die vielen Todesfälle beziehungsweise „Arbeitsmorde“ unter den ausgebeuteten Arbeiterinnen und Arbeitern auf den Schiffswerften in Tuzla. Die Danksagung widmete er einleitend mit den Worten „Niemals vergessen, niemals vergeben, niemals aufgeben“ Süleyman Yeter, einem Arbeitsrechtler bei der Gewerkschaft Limter-İş (die Beschäftigte in Werften sowie in Lagerhäusern und in der Seeschifffahrt vertritt), der 1999 festgenommen und im Polizeigewahrsam zu Tode gefoltert wurde.
Aufgrund seines politischen Aktivismus wurde Suphi Nejat immer wieder festgenommen. Medial tauchte sein Name zum ersten Mal Ende April 2011 nach seiner ersten Festnahme im Zusammenhang mit den sogenannten KCK-Operationen auf. Als bekannt wurde, dass seine Literaturrecherchen und von ihm übersetzte Texte - Suphi Nejat hatte sich schon während seines Studiums einen Namen als angesehener Übersetzer linker Texte und Bücher, darunter Arme, Bettler und Vaganten: Überleben in der Not 1450–1850 von Martin Rheinheimer, oder der Revolutionstheorie des Franzosen Louis-Auguste Blanqui gemacht und schrieb eigene Artikel, vor allem zur kurdischen Frage – in der Anklage gegen ihn als Beweis für eine Mitgliedschaft in der PKK angeführt wurden, veröffentlichten seine Mitstudierenden einen Aufruf mit der Überschrift „Stellt auch Foucault vor Gericht!“.
Nach seiner Freilassung Anfang Mai sagte er in einem Interview mit Bianet: „Sobald sich in der Türkei Sozialisten und libertäre Menschen mit den Kurden zusammenschließen – ganz gleich ob auf politischer Ebene oder im intellektuellen Bereich – wird eine Hexenjagd gegen sie veranstaltet. Diese Hexenjagd findet unabhängig davon statt, auf welche Weise die Annäherung oder Auseinandersetzung mit der kurdischen Frage vonstattengeht. In diesem Land wird eine Operation gegen Menschen geführt, die sich für Arbeit, Freiheit und die gesellschaftliche Kohäsion einsetzen. Ein verantwortungsbewusster Mensch zu sein bringt eben gleichzeitig mit sich, mit irgendetwas beschuldigt zu werden.”
Die „KCK-Operation“ genannte Verhaftungswelle begann nur einen Tag, nachdem die KCK (Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans) am 13. April 2009 ihre Waffenruhe bis zum 1. Juli verlängert und in ihrer Deklaration davon gesprochen hatte, dass „zum ersten Mal die Möglichkeit besteht, die kurdische Frage in einem Umfeld der Waffenruhe zu lösen“. Die Operation, die mit der Verhaftung von Politiker*innenn und Vertreter*innen von NGOs begann, ergriff wellenförmig alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und betraf auch Bürgermeister*innen, Gewerkschafter*innen, Journalist*innen, Verteidiger*innen der Menschenrechte und Rechtsanwält*innen. Am Ende der Operation im Jahre 2011 waren etwa 10.000 Menschen unter dem Verdacht der Mitgliedschaft in der KCK verhaftet worden.
Entführungsversuch mitten in Istanbul
Einen Monat nach seiner Festnahme versuchten Personen, die sich als Polizisten ausgaben, Suphi Nejat in Istanbul aus einer Straßenbahn heraus zu verschleppen. Er machte die Sache öffentlich und erklärte bei einer Pressekonferenz in der IHD-Zentrale: „Wären meine Freunde nicht gewesen, hätte man mich verschwinden lassen.“ Damit spielte er auf die Praxis des „Verschwindenlassens” an. Seit den 1980er Jahren gelten in der Türkei tausende Menschen, größtenteils Kurdinnen und Kurden, als „verschwunden”. Mitte der 90er Jahre, als der schmutzige Krieg des türkischen Staates gegen die PKK besonders blutig war, erreichte diese Methode ihren Höhepunkt. Schätzungen gehen von über 17.000 „Verschwundenen“ durch „unbekannte Täter“ – das heißt durch parastaatliche und staatliche Kräfte - während dieser dunklen Periode unter Ministerpräsidentin Tansu Çiller aus. Die Leichen wurden in Massengräbern, Höhlen oder in stillgelegten Industrieanlagen verscharrt, auf Müllhalden geworfen, in Brunnenschächten und Säuregruben versenkt oder wie in Argentinien durch den Abwurf aus Militärhubschraubern beseitigt. Oft waren die Betroffenen von der Polizei oder der Armee zu Hause abgeholt worden, oder man hatte sie in die Wache vor Ort zu einer „Aussage“ bestellt, oder sie waren bei einer Straßenkontrolle des Militärs festgehalten worden. Das ist oft das letzte, was ihre Angehörigen vom Verbleib der Vermissten wissen.
Weder Armenier noch Alevite, und auch kein Kurde
In Rojava legte sich Suphi Nejat den Nom de Guerre Paramaz Kızılbaş zu. Kızılbaş, also „Rotköpfe“, waren seit etwa der Mitte des 15. Jahrhunderts Anhänger des schiitischen Sufi-Ordens der Safawiden. Heute wird der Ausdruck in bestimmten Regionen als Synonym für die Schia und Aleviten verwendet. Paramaz war der Codename des armenischen Guerillakämpfers Matteos Sarkissian, der zu den ersten Sozialisten im Osmanischen Reich gehörte und am 15. Juni 1915 zusammen mit 19 Mitstreitern von der sozialdemokratischen Huntschak-Partei am Beyazıt-Platz in Istanbul im Zuge des Völkermords an den Armeniern hingerichtet wurde.
„Ob Stalingrad oder Kobanê - Unsere [Widerständigen] kämpfen immer mit der gleichen Entschlossenheit” | SGDF
Dass Suphi Nejat diesen Kampfnamen annahm, war eine klare politische Botschaft. Denn weder war er ein Alevite noch Armenier. Und er war kein Kurde. Aber er wusste, was sein Entschluss bedeutete, im August 2014 nach Kobanê zu gehen, um in den Reihen der YPG gegen den IS zu kämpfen. Denn es waren seine Ideen und Gedanken, die er sein Leben lang verteidigt hatte, und die nun im Kampf praktische Gestalt annahmen. Es war die Zeit, als die Terrormiliz die Şengal-Region in Südkurdistan überfallen und einen Genozid an der ezidischen Bevölkerung verübt hatte. Gerade einmal sechs Wochen später richtete sie sich erneut – die Versuche Kobanê einzunehmen begangen schon Ende 2013 – und diesmal mit einer noch größeren Mobilisierung gegen Kobanê. Der Kanton war damals von drei Seiten von den Dschihadisten eingekreist, auf der vierten Seite stand die türkische Armee. Tausende Söldner griffen mit hochtechnologischem Kriegsgerät an, demgegenüber versuchten die YPG/YPJ, Kobanê mit Kalaschnikows, Maschinengewehren und Pistolen zu halten.
Von seiner Familie oder seinen Freund*innen verabschiedet hatte sich Suphi Nejat nicht. An der Tür zu seinem Zimmer, dass er ordentlich aufgeräumt hinterlassen hatte, hing nur ein Zettel mit dem Hinweis: „Der September naht.” Man dachte, er sei aufgebrochen nach Lateinamerika, wo er schon immer hin wollte. Fast ein Jahr lang hatte er deshalb einen Spanischkurs besucht. In einem Brief, den er in Kobanê verfasste, schrieb er später: „Als gewöhnlicher junger Mensch traf ich aufgrund meiner gewöhnlichen Widersprüche eine einfache Entscheidung. In erster Linie habe ich diese Wahl für mich selbst getroffen. Es ist kein Weg zu einem erhabenen Zweck, für den ich mich entschieden habe. Mit Menschen, die nicht erhaben sind, wollte ich lediglich das Leben und diese trostlose und verdinglichte Welt verzaubern. Ich habe gelernt, dass meine Widersprüche nicht überwunden werden können, weil sie sozialer Natur sind, und nur durch Organisierung auf einer höheren Ebene gesellschaftsfähig sein können. Dies hier ist der Punkt, an dem ich in meinem bisherigen Leben der Wahrheit am nächsten bin. (...) Mit der Hoffnung, dass Ihr im Westen der Türkei die Samen eines großen Auswegs sät, der das Leben ganz gewöhnlicher Arbeiter faszinieren und ganz gewöhnliche Helden zum Vorschein bringen wird, und die federführende Organisation der Suche nach der Wahrheit erschaffen werdet. Jedes Herz ist eine revolutionäre Zelle! Die Phantasie an die Macht!”
An einem Tag im Oktober starb er. Der Tod des Suphi Nejat Ağırnaslı, des Paramaz Kızılbaş, dem Sozialisten und Internationalisten, der weder Armenier noch Alevite, und auch kein Kurde war, aber all diese Identitäten und noch viel mehr in seiner Person vereinte, hatte viele Menschen schwer getroffen. Sein Vater, der Autor Hikmet Acun, beschrieb seine Gefühlslage nach der Nachricht vom Tod des eigenen Kindes damals mit den Worten: „Ich habe meinen Sohn, meinen Genossen, meinen Bruder Nejat in Kobanê verloren. Er hätte ein glänzendes Leben vor sich haben können. Aber er entschied sich für die revolutionäre Solidarität. Er hielt sein Wort und hat mich nicht enttäuscht. Er hat bewiesen, dass er ein Teil von mir ist. Ich verneige mich vor ihm voller Respekt.“
Der Miştenûr nach der Befreiung vom IS
„Solche dramatisch geballten, solche schicksalsträchtigen Stunden, in denen eine zeitüberdauernde Entscheidung auf ein einziges Datum, eine einzige Stunde und oft nur eine Minute zusammengedrängt ist, sind selten im Leben eines Einzelnen und selten im Laufe der Geschichte. […] Ich habe sie so genannt, weil sie leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht der Vergänglichkeit überglänzen.“ Stefan Zweig
Was er mit dem eingelösten Versprechen meinte, behielt Hikmet Acun für sich. Als man im Dezember 2015 die sterblichen Überreste seines Sohnes fand, war sofort klar, dass Suphi Nejat Ağırnaslı in Kobanê beigesetzt werden würde. Diesen Wunsch hatte er den YPG als „internationalistischer Revolutionär“ in einer Willenserklärung mitgeteilt. Begraben wurde er auf dem Gefallenenfriedhof „Şehîd Dîcle“, neben hunderten seiner Freundinnen und Freunde. Hikmet Acun kehrte nach der Zeremonie nicht wieder in die Türkei zurück. Er lebt und arbeitet heute in Rojava.