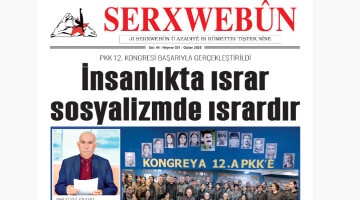Bildung in Kurdî im Fokus von Fachkonferenz
Unter dem Titel „Auf dem Weg zur Lösung in der muttersprachlichen Bildung: Möglichkeiten, Hindernisse, Vorschläge“ veranstaltet die Bildungsgewerkschaft Eğitim Sen in der kurdischen Provinzhauptstadt Amed (tr. Diyarbakır) einen Workshop. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Forderung nach einer rechtlichen und gesellschaftlichen Anerkennung der kurdischen Sprachen als Teil einer demokratischen Bildungsstruktur in der Türkei.
Akademiker:innen, Jurist:innen, Journalist:innen und zahlreiche Gäste versammelten sich am Morgen im Kongresszentrum Çand Amed, um über die strukturellen Barrieren und Perspektiven für mehrsprachige Bildung zu diskutieren. In mehreren Beiträgen wurde deutlich: Bildung in der Muttersprache ist kein Randthema – sondern zentral für Chancengleichheit, Demokratie und Frieden.

Kurd:innen wurden systematisch aus dem öffentlichen Raum verdrängt
In der ersten Podiumsrunde, die unter dem Titel „Das Problem der muttersprachlichen Bildung im türkischen Rechtssystem“ stand, zeichnete der Jurist Müslüm Dalar vom Vorstand der örtlichen Rechtsanwaltskammer die historischen Linien der Repression gegen die kurdische Sprache nach. Er erinnerte daran, dass Kurdisch einst eine etablierte Bildungs- und Wissenschaftssprache in den Medresen war – bis im Zuge des Aufstiegs des Nationalstaats die Sprachverbote institutionalisiert wurden.
„1924 wurde mit der neuen Verfassung der Republik die Basis für ein einsprachiges System gelegt. Später folgten Ausnahmegesetze, Notstandsverordnungen und Sondermaßnahmen – mit dem Ziel, Kurd:innen zu entmündigen und zu assimilieren“, erklärte Dalar.
Auch nach der Militärdiktatur 1980 seien kurdische Ausdrucksformen selbst in Alltagskontexten wie Musik, Hochzeiten oder öffentlichen Reden unter Strafe gestellt worden. Die Anerkennung von Kurdisch als Unterrichts- oder Verwaltungssprache sei nicht nur eine Frage des Rechts, sondern der Demokratisierung der Türkei insgesamt, so der Jurist.
Völkerrechtliche Verpflichtungen – aber politische Blockaden
Der Anwalt Serhat Hezer vom Verband freiheitlicher Jurist:innen (ÖHD) erinnerte daran, dass die Türkei völkerrechtlich zur Achtung sprachlicher und kultureller Rechte verpflichtet sei – etwa durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder die UN-Erklärung zu Minderheitenrechten von 1992. Doch in zentralen Punkten habe Ankara Vorbehalte beziehungsweise „Schranken“ eingetragen, insbesondere dort, wo es um kollektive sprachliche Rechte geht. „Die türkische Verfassung wurde auf Grundlage eines einheitlichen Staats- und Sprachverständnisses entworfen. Das spiegelt sich auch in der internationalen Politik wider: Pluralität wird nicht anerkannt, weder nach innen noch nach außen“, so Hezer.

„Sprache ist Leben – und die Grundlage von Gleichheit“
Zum Abschluss des Panels sprach Cemile Turhallı, Ko-Sprecherin der Kommission für Sprache, Kultur und Kunst der DEM-Partei. Sie betonte, dass die bisherigen Verfassungen der Republik Türkei (1924, 1961, 1982) alle den Gebrauch des Kurdischen systematisch ausgeschlossen hätten – sowohl im individuellen als auch im kollektiven Kontext.
„Mit der Verfassung von 1982 wurde die türkische Sprache sogar als unantastbares Dogma festgeschrieben“, so Turhallı. „Die Staatsbürgerschaft wurde auf eine ethnische Definition verengt – alle anderen Gruppen wurden als Bedrohung konstruiert. So entstand der sogenannte ‚Kurdenkonflikt‘– oder wie er im offiziellen Diskurs genannt wird: das ‚Ostproblem’, das ‚Terrorproblem’, das ‚Sicherheitsproblem’.“
Sprache sei dabei nicht nur ein kulturelles oder politisches Thema, sondern berühre ganz konkrete Lebensrealitäten: „Das Recht auf die eigene Sprache ist eng mit anderen Grundrechten verbunden – mit dem Recht auf Bildung, Gesundheit, Gleichbehandlung. Kinder, die ihre Muttersprache nicht sprechen dürfen, sterben unnötig in Krankenhäusern, haben keine faire Chance im Bildungssystem, leiden unter Ausgrenzung.“

Vorschläge für eine demokratische Lösung
Cemile Turhallı forderte grundlegende politische und juristische Reformen, darunter:
▪ Abschaffung des ethnisch definierten Staatsbürgerschaftsbegriffs, stattdessen: inklusive „Staatsbürgerschaft der Republik Türkei“
▪ Verfassungsreform: Abschaffung diskriminierender Artikel (u.a. Art. 3, 4, 42, 66)
▪ Positivpflicht für den Staat, muttersprachliche Bildung zu ermöglichen
▪ Anerkennung von mindestens zwei Amtssprachen
▪ Mehrsprachigkeit in der öffentlichen Verwaltung und in staatlichen Dienstleistungen
▪ Anerkennung von Pluralismus als Grundlage nationaler Einheit
„Eine Gesellschaft, die keinen Sprachenfrieden schafft, wird auch keinen sozialen Frieden erreichen“, schloss Turhallı. „Mehrsprachigkeit und Multikulturalität sind kein Risiko – sie sind das Rückgrat einer demokratischen Republik.“
Der Workshop wird nach einer Mittagspause mit einer zweiten Diskussionsrunde fortgesetzt.