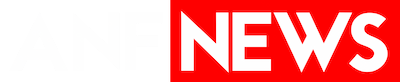Monika Morres wird von vielen Kurdinnen und Kurden in Deutschland als „Platane der Menschenrechte“ bezeichnet - ein mächtiger Baum mit tiefen Wurzeln und weit reichenden Ästen. Seit drei Jahrzehnten engagiert sich die heute 73-Jährige gegen die Kriminalisierung des kurdischen Volkes – viele Jahre davon als Mitarbeiterin des nach dem Betätigungsverbot der PKK in Deutschland gegründeten Rechtshilfefonds Azadî e.V. mit Sitz in Köln. Die Journalistin Dîlan Karacadağ hat für die Tageszeitung Yeni Özgür Politika ein Interview mit Morres geführt. Darin gewährt die Tochter eines Siebenbürgeners sehr offen Einblicke in ihr Privatleben, von ihrer ersten politischen Aktivität beim Sternmarsch auf Bonn 1968 über ihre Zeit als Abgeordnetenmitarbeiterin bis zu ihrer ersten Reise nach Kurdistan.
In was für eine Familie bist du geboren? Hast du Geschwister, bist oder warst du verheiratet?
Meine Familie mütterlicherseits kommt aus dem Rheinland, die meines Vaters aus Siebenbürgen. Das ist ein Gebiet, das im Zentrum und Nordwesten des heutigen Rumäniens liegt und eine lange wechselvolle Geschichte hat.
In aller Kürze: Historisch gesehen begannen im 12. und 13. Jahrhundert deutsche Siedler – insbesondere aus der Eifel-, Mittelrhein- und Moselregion, aber auch aus Flandern und der Wallonie – sich in Siebenbürgen anzusiedeln. Sie waren von Ungarn gerufen wurden, um das Land gegen Angriffe aus dem Osten zu sichern und die Wirtschaft zu stärken. Dafür erhielten sie von dem ungarischen König Andreas II. weitreichende Sonderrechte. Die Siedler*innen gründeten viele Städte und Dörfer, die auch heute noch wichtig sind, zum Beispiel Kronstadt, Hermannstadt oder Klausenburg.
In den nachfolgenden Jahrhunderten gab es weitere Einwanderungswellen, etwa im Zuge der Reformation und Gegenreformation, weil in Siebenbürgen Glaubensfreiheit herrschte. Viele Protestanten kamen aus dem Erzherzogtum Österreich hinzu. Im Jahre 1920 wurde im Vertrag von Trianon festgelegt, dass Siebenbürgen durch Rumänien übernommen wird. Es entwickelte sich der rumänische Einheitsstaat. Die Toleranz gegenüber vielen Ethnien in Siebenbürgen, unter anderem Armeniern, wurde dadurch stark beeinträchtigt. Theoretisch wurde ihnen weitergehende Rechte eingeräumt, praktisch jedoch nicht angewendet.
Bei der Frage, woher mein Name „Morres“ stammt, gibt es eine mögliche Antwort. Danach soll sich der ursprünglich französisch-belgische Familienname „Maurice“ im Laufe der Zeit in „Morres“ verändert haben. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht.
Meine Großmutter Alice war Professorin für Mathematik, was für die damalige Zeit außerordentlich gewesen ist. Mein Großvater, Hermann Morres, war Professor für Kunstgeschichte, Kunstpädagoge, Komponist und ein recht bekannter Maler. Außerdem schrieb er regelmäßig für die „Kronstädter Zeitung“ und das „Siebenbürgisch-Deutsche Tageblatt“. Ich habe noch Ausgaben von 1913 und 1918. Die Familie lebte in Kronstadt. Während mein Großvater bis zu seinem Tod im Jahre 1971 dort blieb, verließ meine Großmutter Rumänien nach Westdeutschland.
Meine Mutter, Tochter eines Schusters und Inhaber eines Schuhladens, „durfte“ in den 1930er Jahren die Kleinstadt verlassen und nach München gehen, um dort eine Ausbildung zur Sekretärin zu machen. Das war für die damalige Zeit nichts Selbstverständliches. Dort lernte sie meinen Vater kennen, der in München Architektur studierte. Im Krieg war er als Soldat in Finnland eingesetzt und sehr früh durch einen Kopfschuss verletzt worden; er verlor ein Auge.
Nach dem Krieg sind beide ins Rheinland zurückgekehrt und haben versucht, sich eine neue Existenz aufzubauen. Ich bin 1947 geboren, mein Bruder fünf Jahre später. Inzwischen sind meine Eltern und mein Bruder – damit meine Kernfamilie - leider tot. Ich war zweimal verheiratet.
Hast du studiert oder eine Ausbildung gemacht? Wie war dein Arbeitsleben, bevor du politisch aktiv geworden bist? Hast du dich durch ein Buch, eine Tat oder durch Menschen radikalisiert?
Ich habe meine Schulzeit in einer katholischen Klosterschule verbracht, was für mich schon als Kind eine Qual gewesen ist, weil das System dort autoritär und repressiv war. Das erweckte in mir schon sehr früh eine widerständige Haltung. Immer wieder gingen so genannte „Blaue Briefe“ an meine Eltern mit der Warnung, mich aus der Schule zu entfernen.
Ich habe es bis zum Schluss geschafft. Aufgrund der schrecklichen Erfahrungen in dieser Schule bin ich sehr schnell aus der katholischen Kirche ausgetreten.
Gerne hätte ich nach der Schule studiert – Archäologie –, was aber aus finanziellen Gründen nicht möglich war. So habe ich – leidenschaftslos – eine Ausbildung im Verwaltungsbereich absolviert und dann eine Tätigkeit im Bundesinnenministerium aufgenommen, anfangs ebenfalls leidenschaftslos.
Dann hatte die damalige Große Koalition aus CDU und SPD, Bundesinnenminister war Ernst Benda, Pläne für die Einführung von sogenannten Notstandsgesetzen. Dagegen gab es schon im Vorfeld massive Proteste, insbesondere durch die Außerparlamentarische Opposition (APO). In Bonn fand im Mai 1968 die erste Großdemonstration – der Sternmarsch – mit Zehntausenden Menschen statt. Dort sprach neben vielen bekannten Menschen auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Wolfram Dorn. Die FDP lehnte damals das gesamte Notstandspaket ab, das Regelungen beinhaltete für einen fiktiven Verteidigungs-, Spannungs- und Katastrophenfall sowie einen sogenannten inneren Notstand. In solchen Fällen hätten zahlreiche Grundrechte beschränkt werden können. Trotz der vielen Proteste wurden diese Notstandsgesetze dann vom Bundestag verabschiedet.
Die Teilnahme an dieser Demonstration war meine erste politische Aktivität und ich war begeistert von so vielen protestierenden Menschen in der Stadt und auf der Hofgartenwiese, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Begeistert erzählte ich Kolleginnen danach von diesem Ereignis. Was Folgen hatte. Ich wurde zur Personalabteilung zitiert und gerügt.
1969 wurde die Große Koalition abgewählt und es kam die Sozialliberale Koalition aus SPD und FDP. Mit Hans-Dietrich Genscher – dem späteren Außenminister – als Bundesinnenminister, zog auch sein Stellvertreter, der Parlamentarische Staatssekretär ins Ministerium. Sein Name: Wolfram Dorn, derjenige also, der auf der Hofgartenwiese gesprochen hatte.
Wurde meine Teilnahme an der Demo 1968 zuvor noch kritisiert, so war sie jetzt für mich ein Pluspunkt. Trotz massiver Intervention der Personalabteilung hat sich der Staatssekretär entschieden, eine Kollegin und mich als Mitarbeiterin in sein Büro zu berufen wegen der Demo.
Ich war 22 und es begann für mich eine außerordentlich interessante und ereignisreiche Zeit – positiv wie negativ. Gelernt habe ich unendlich viel und war ganz nahe an den politischen Ereignissen, Auseinandersetzungen, Entwicklungen und am „Blick hinter die Kulissen“ der „großen Politik“.
Es begann die Zeit der „neuen Ostpolitik“, der historischen deutsch-deutschen Begegnungen in Erfurt und Kassel zwischen Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) und DDR-Ministerpräsident Willi Stoph im März beziehungsweise Mai 1970. Mein damaliger Chef gehörte auch zu den Delegationsteilnehmern. Nach einer langen Phase der Konfrontation ging es um eine Normalisierung des Verhältnisses zwischen der BRD, der DDR und den Ostblockstaaten durch Verhandlungen. Am Ende dieses Prozesses standen wichtige zwischenstaatliche Verträge und Abkommen, in dessen Verlauf es zu massiven Auseinandersetzungen mit konservativen und rechten Kräften gekommen war.
Es war auch die Zeit der 68er-Studierendenbewegung, die sich kraftvoller und radikaler zu einer linken Massenbewegung entwickelte. Frauen organisierten sich, nahmen sich ihre Rechte, gingen selbstbewusst für ihre Forderungen auf die Straße und attackierten das patriarchale, machohafte Verhalten auch linker Männer. Sie kämpften für ihr Recht auf Schwangerschaftsabbruch, sie gründeten Frauen-Buchläden, Frauen-Archive, Frauen-Museen und forderten Lehrstühle für frauenbezogene Geschichtsforschung.
Positiv erlebt habe ich auch die progressiven Entwicklungen im kulturpolitischen Bereich, für den der Staatssekretär auch zuständig gewesen ist. Es ging um die Umsetzung der experimentellen Ideen für den „Neuen deutschen Film“. Protagonisten waren damals die „Jungfilmer“ – Regisseure wie Rainer Werner Fassbinder oder Volker Schlöndorff, die auch von der 68-er Protestbewegung beeinflusst waren. Für die Projekte gab es staatliche Gelder aus der Filmförderung. An solchen Verhandlungen habe ich häufig als Protokollantin teilgenommen und diese interessanten Menschen kennengelernt.
Negativ war zweifellos der Extremisten- beziehungsweise Radikalenerlass, den ausgerechnet die sozialliberale Koalition – die SPD hatte im Wahlkampf 1969 noch „mehr Demokratie wagen“ gefordert – unter Willy Brandt und die Bundesländer 1972 beschlossen hatten. Mit diesem Instrument sollte die Beschäftigung von „Verfassungsfeinden“ im öffentlichen Dienst verhindert werden. Das führte dazu, dass es vor jeder möglichen Einstellung eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz gegeben hat. Bewerber*innen, die angeblich verfassungsfeindlich aktiv waren, wurden entweder nicht eingestellt oder entlassen. Dies galt sowohl für Beamt*innen als auch Angestellte. Davon betroffen waren Tausende von Menschen, die mit dem Stempel „linksextrem“ nicht als Lehrer*innen oder Postbeamt*innen eingestellt oder entlassen wurden. Es gab nicht nur in Deutschland massive Kritik an diesem Erlass als Verletzung des Rechts auf Meinungsfreiheit und Verstoß gegen das Völkerrecht. Auch international intervenierten Organisationen und Persönlichkeiten, insbesondere in Frankreich.
Es gäbe noch sehr viel mehr zu erzählen, zum Beispiel über die Zeit der RAF zu Beginn der 1970er-Jahre, die ich teilweise noch in dem Staatssekretärs-Büro erlebt habe. Unter dem Kampfbegriff „Baader-Meinhof-Bande“ wurde der staatliche Apparat hochgerüstet – bis hin ins Ministerium. Auf den Fluren der Minister- und Staatssekretärsebene patrouillierten bewaffnete Kräfte, Autos wurden bei Ein- und Ausfahrten kontrolliert, auch die Fahrer*innen und weitere umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen installiert. In meiner Erinnerung war diese Zeit gespenstisch.
Gleichzeitig aber habe ich begonnen, mich auch für die politischen Hintergründe und Motivationen „der anderen Seite“ zu interessieren und vieles hierzu gelesen. Das hat nicht zuletzt dazu geführt, dass ich später an Demonstrationen zur Freilassung der politischen Gefangenen teilgenommen habe.
Das Attentat von bewaffneten Palästinensern auf israelische Sportler*innen bei der Olympiade 1972 in München habe ich während meiner Zeit im Ministerium auch noch erlebt. Mit dieser Aktion wollten sie die Freilassung von in Israel inhaftierten Genoss*innen, aber auch von den RAF-Mitgliedern Ulrike Meinhof und Andreas Baader erreichen. Weder ist Israel der Forderung nachgekommen, noch die BRD. Es wurden Menschen getötet und andere als Geiseln genommen. Versuche der Polizei, sie zu befreien, scheiterten total.
Nach dem Rücktritt des Staatssekretärs im Herbst 1972 endete auch meine Arbeit dort. Die Perspektive, irgendwo im Ministerium untergebracht zu werden, war nicht meine. Ich bin gegangen und habe eine Zeit lang im Arbeitskreis Innenpolitik der FDP-Bundestagsfraktion gearbeitet – eine neue Erfahrung. Das Angebot, in einen Verlag zu wechseln mit einem politischen Literaturprogramm, in dem ich selbstständig arbeiten konnte – Büroleitung, redaktionelle Tätigkeit unter anderem -, habe ich gerne angenommen.
Weil strukturelle Änderungen, die nicht meinen Interessen entsprachen, eingeführt werden sollten, habe ich den Verlag nach fünf Jahren verlassen. Um Abstand von allem zu gewinnen und den Kopf für Neues frei zu bekommen, bin ich mit meinem damaligen Partner mehrere Monate in einem Wohnmobil durch Europa gereist. Damals waren viele junge Menschen unterwegs, teils auf Weltreise. So trafen wir Leute, die aus Indien, Nepal oder Australien kamen oder auf dem Weg dorthin waren. Ich erinnere mich sehr gut an ein Ehepaar aus London – beide etwa 80-jährig –, die mit einem alten umgebauten Gefängniswagen unterwegs waren und sich vorgenommen hatten, irgendwo unterwegs, aber keinesfalls zu Hause, zu sterben. Wir fühlten uns auf eine gewisse Art und Weise „frei“.
Zurückgekommen von dieser Reise, habe ich eine Arbeit im Bereich Verbraucher-Politik aufgenommen und einige Jahre in der Pressestelle gearbeitet und dort bestimmte Strukturen aufgebaut. Danach hatte ich ein Eindruck, mich nicht weiterentwickeln zu können und bin 1980 wieder „in die Politik“ gegangen, und zwar als Mitarbeiterin eines FDP-Abgeordneten, der dem linken Flügel der Partei zuzurechnen war.
Der zunehmend negative Einfluss des Wirtschaftsflügels in der FDP um Otto Graf Lambsdorff und Hans-Dietrich Genscher führte zu massiven Erosionsprozessen in Partei und Fraktion und letztlich 1982 zum Bruch der sozialliberalen Koalition. Linksliberale traten aus der Partei aus – darunter geschlossen der progressive FDP-Jugendverband, die Jungdemokraten. Ein Teil versuchte es mit der Gründung einer neuen Partei („Liberale Demokraten“), ein anderer wechselte zur SPD – wie Günter Verheugen oder Ingrid Matthäus-Maier. Wieder andere verblieben in der FDP– wie der verstorbene Burkhard Hirsch oder Gerhart Baum bis heute.
Mit dieser sehr kurzen Schilderung möchte ich deutlich machen, dass es bei mir nie eine wirkliche Trennung gegeben hat zwischen dem Beruflichen und Politischen, was sich letztlich auch im Privaten fortgesetzt hat. Mir war und ist es wichtig, einen klaren Standpunkt und eine Überzeugung davon zu haben, was richtig und falsch ist. Das theoretische Fundament für meine Haltung habe ich mir als Autodidaktin geschaffen durch Lesen und noch mal Lesen, Reflektieren, Analysieren, Diskutieren. Das ist ein permanenter, anstrengender, aber lohnenswerter Prozess.
Deshalb kann ich die Frage, was mich radikalisiert hat, so gar nicht beantworten. Es war nicht nur EIN Ereignis, es war die Dynamik der Zeit. Außerdem meine ich, dass Radikalität allein ja noch kein Programm ist. Ich habe häufiger die Erfahrung gemacht, dass sich besonders radikal gebende Leute ganz schnell wieder verabschiedet haben.
Es kommt darauf an, ernsthaft und kontinuierlich politisch zu arbeiten und zu wissen, auf welcher Seite der Barrikade man/frau steht. Hierzu braucht es Standfestigkeit.
Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal etwas über die Kurden gehört hast?
Ach je - da ich ja schon älter bin (vor drei Monaten 73 geworden), muss ich mehrere Jahrzehnte zurückgehen. Aber ich erinnere mich sehr gut. Es war Ende der 1970er Jahre, als ich an einem Karnevals-Samstag einen jungen Mann aus der Türkei kennenlernte, der darauf bestand, kein Türke, sondern ein Kurde zu sein. Kurde? Das hat mich natürlich sehr neugierig gemacht und ich habe durch ihn mehr erfahren. Mein Versuch, in Buchhandlungen oder der Stadtbibliothek mehr zu dem Thema zu finden, endete beim „Durchs wilde Kurdistan“ von Karl May. Aber ich suchte Fachliterarisches, was nicht zu bekommen war. Erst später war ich bei der Suche erfolgreich, die Beziehung mit dem jungen Mann wars nicht.
Was hast du vor AZADÎ gemacht?
Viel verschiedenes, immer aber im politischen Bereich. Ich glaube, die vollständige Geschichte ergäbe auch eine Broschüre. Ich habe über 20 Jahre im Bundestag gearbeitet – als Mitarbeiterin von Abgeordneten oder in Fraktionen. Interessant war die Vorstandszeit der ersten Legislaturperiode der Grünen, die 1983 erstmals in den Bundestag einziehen konnten. Nicht weniger aufregend dann die Phase, als 1984 das Feminat gewählt wurde: eine Fraktionsführung von sechs Frauen! Das war historisch. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Die männlichen Abgeordneten im Parlament drehten fast durch, auch in den eigenen Reihen. So Josef Fischer (Joschka genannt, späterer Außenminister), der in Bonner Kneipen gegen die Frauen herumätzte.
Nach der Zeit bei den Grünen, die sich letztlich recht schnell in das Parlamentssystem integriert und viele ihrer politischen Grundsätze aufgegeben haben, habe ich mehrere Jahre bei einer PDS (später Linkspartei)-Abgeordneten gearbeitet. Das Thema Kurdistan spielte bei der parlamentarischen Arbeit eine wichtige Rolle.
Es war mir aber immer wichtig, mich auch außerparlamentarisch zu engagieren – viele intensive Jahre im antifaschistischen/feministischen Bereich. Gleichzeitig bin ich durch das erste Großverfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf gegen 19 kurdische Aktivist*innen (1989 – 1994) wieder mit der „Kurdischen Frage“ in Kontakt gekommen und damit natürlich auch mit Kurdinnen und Kurden. Mitte der 1990er Jahre gehörte ich mit einem Freund eine Zeitlang dem Vorstand des örtlichen kurdischen Vereins an.
In der Türkei und Kurdistan war ich mehrere Male – mit Delegationen und „privat“. Kennengelernt habe ich Amed, Dersim, Çewlîk, Êlih, Hasankeyf und Wan. Einmal war ich mit einem Freund im nordsyrischen Efrîn. Wir haben dort bei einer befreundeten Familie gewohnt und einen intensiven Eindruck von Land und Leuten gewinnen können. Ich glaube, das war etwa 1998. Es ist kaum zu ertragen, welche Verheerungen in dieser Region angerichtet worden sind.
Wie waren deine Eindrücke, als du das erste Mal in Kurdistan warst?
Nach dem ersten Besuch in Kurdistan bin ich begeistert zurückgekommen. Er hat mich darin bestärkt, meine Aktivitäten „zu Hause“ noch überzeugter fortzusetzen. Ich habe auch die Erkenntnis gewonnen, dass es wichtig ist, sich durch Besuche vor Ort selbst ein Bild zu machen und noch mehr Verständnis für die Situation der Menschen zu entwickeln.
Wann warst du das letzte Mal in Kurdistan oder in der Türkei? Siehst du den Unterschied zwischen der kurdischen Diaspora und Kurd*innen in Kurdistan?
Leider liegt das lange zurück. Es war im Mai 2005, als ich mit einem Freund an einer internationalen Konferenz unter dem Motto „Friede im Mittleren Osten und das Recht der Bevölkerung auf Frieden“ in Amed teilgenommen habe, die vom damaligen Oberbürgermeister Osman Baydemir eröffnet wurde. So konnte die „Demokratieplattform Diyarbakir“ erstmals die ‚kurdische Frage‘ in einem internationalen Rahmen in Kurdistan selbst organisieren. Delegationen und Einzelpersonen aus vielen Ländern waren angereist, um offen alle Aspekte des Themas anzusprechen und über die unterschiedlichen Sichtweisen zu diskutieren. Das Interesse war außerordentlich und der Sitzungsraum an allen Tagen bis auf den letzten Platz besetzt. Eine Teilnahme der Öffentlichkeit hatten die türkischen Behörden untersagt. Allerdings gab es ein „Offenes Forum“, das nicht im offiziellen Programm aufgeführt war. Und sofort erschien die Zivilpolizei, die den Ablauf gefilmt hat, was aber niemand gehindert hat, trotzdem zu reden. Neben den zahlreichen internationalen Redner*innen, sprachen auch eine Vertreterin der Friedensmütter, eine kurz zuvor aus der Haft entlassene Guerillakämpferin aus der „ersten Friedensgruppe“ sowie das ehemalige DEP-Mitglied Orhan Doğan, der 2004 auf freien Fuß gesetzt worden war.
Im Anschluss an die Konferenz war eine Fahrt nach Hasankeyf – ich war dreimal dort – organisiert worden.
Mein subjektiver Eindruck bei den Reisen war häufig, dass die Menschen in Kurdistan trotz der angespannten und gefährlichen Situation mutiger und kraftvoller sind als die Kurd*innen in der Diaspora (ich bitte, dies zu entschuldigen). Das gilt besonders für die vielen Frauen, mit denen wir zusammengetroffen sind und intensive Gespräche geführt haben. Die meisten von ihnen hatten unsägliches Leid erfahren, was ihnen dennoch die Kraft gegeben hat, sich nicht aufzugeben, sondern zu kämpfen. Sie wollten mit uns über ihre persönliche und die politische Situation sprechen und darüber, wen sie als ihre Interessensvertretung anerkennen und unterstützen. Dass vielleicht wenig später eine Razzia in ihren Wohnungen die Folge war oder eine Festnahme, hat sie nicht eingeschüchtert. Wir sollten die Öffentlichkeit in Deutschland über ihre Situation informieren und aufklären. Was wir auch durch Vorträge, Veranstaltungen oder Broschüren getan haben.
Ich habe jedenfalls sehr große Achtung vor den Menschen in Kurdistan. Die Gastfreundschaft der Kurdinnen und Kurden ist außerdem legendär und hat mich immer wieder beschämt, wenn ich daran dachte, wie ungastlich und abweisend sich Deutschland verhält.
Wie beurteilst du die deutschen zivilgesellschaftlichen linken und feministischen Organisationen bezüglich der ‚Kurdenfrage‘? Wie aufrichtig findest du deren Kampf, Solidarität und Unterstützung?
Gegenwärtig ist mein Eindruck, dass es eine bessere Zusammenarbeit mit linken Organisationen gibt, was zweifellos mit der Revolution von Rojava, dem Konzept der föderativen Basisdemokratie, der Gleichberechtigung der Geschlechter, Religionen und Ethnien zusammenhängt. Mit einem solchen Gesellschaftsmodell können sich viele Linke identifizieren, einige waren/sind gar bereit, sich den Selbstverteidigungskräften anzuschließen und die Errungenschaften gegen Angriffe sowohl des IS als auch der türkischen Armee zu verteidigen.
Bei zahlreichen Demonstrationen unterschiedlichster Gruppierungen zu unterschiedlichen Themen spielen die Situation der Kurd*innen, die Verbotspolitik der Bundesregierung und die Kriegspolitik der Türkei, eine Rolle. Es gibt auch mehr nichtkurdische Aktivist*innen, die wegen des Zeigens von PKK- oder YPG/YPJ-Symbolen strafrechtlich verfolgt werden.
Für den Repressionsapparat jedenfalls wirkt eine solche Zusammenarbeit wie ein „rotes Tuch“, das zerschnitten werden muss. Dagegen müssen wir unsere Solidarität setzen und uns den Spaltungsversuchen widersetzen. Deshalb ist es wichtig, Gemeinsamkeiten zu finden und diese offensiv zu vertreten. Kontinuierliche Anstrengungen auf beiden Seiten ist hierfür Voraussetzung. Ich möchte optimistisch sein.
Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Wann immer möglich, Fahrradfahren. Und: Ich habe einen Mini-Garten und eine relativ große Terrasse, beides mit vielen Blumen und Pflanzen – die wollen geliebt und gepflegt werden. Und natürlich: Bücher. Ich lese derzeit den 600 seitigen Roman „Exil der frechen Frauen“, in dem es um die Lebenswege von drei Frauen in den 1920er/1930er Jahren, unter anderem Olga Benario, und ihren Widerstand gegen den Faschismus geht. Sehr empfehlenswert. Parallel dazu habe ich den dokumentarischen Roman „Olga“ gelesen, der in der dt. Fassung Ende 1989 erschienen ist.
Ich interessiere mich „natürlich“ für Kunst, insbesondere die Malerei. Und Musik – von Klassik, Beethoven und Tschaikowsky, über Bob Dylan, Reggae, Rhythm & Blues, Rap und guten Rock.
Manchmal ist alles zu viel für einen Tag. Aktuell hat mir mein Arzt für 18 Monate Rehasport verordnet und das mache ich an zwei Tagen in der Woche. Ich muss gestehen: ich habe sehr viel Spaß daran.
Zum Schluss möchte ich sagen, dass mir die Arbeit bei AZADÎ für die Kurd*innen und mit ihnen sehr wichtig ist. Trotz der vielen Zumutungen und Widerstände gehen die kurdischen Freund*innen ihren Weg, der Mut, Beharrlichkeit und viel Kraft erfordert.
Solange die zahlreich bestehenden Probleme nicht gelöst sind, mit denen sie durch die deutsche Politik konfrontiert sind, ist ein solidarisches Engagement alternativlos.