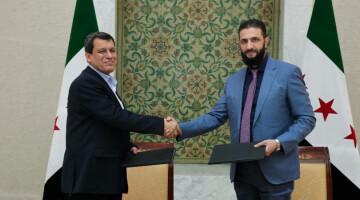Zwischen Tigern und Landminen – Der Widerstand wird lebendig, wenn sie von den Frauen berichtet, die sie seit vielen Jahren begleitet: Dr. Agnes Khoo ist Soziologin an der Shenzhen Technology University in China. Zum 80. Jahrestag des Endes des zweiten Weltkriegs hat sich die 59-Jährige auf die Reise nach Deutschland gemacht, um den Widerstand von Frauen der Guerilla der Kommunistischen Partei Malayas (Communist Party of Malaya, CPM) feministisch einzuordnen.
Für ihr Buch „Life as the River Flows“ aus dem Jahr 2004 interviewte sie mehrere Widerstandskämpferinnen aus Thailand, Singapur und Malaysia, die gegen den japanischen Faschismus und den rund 200 Jahre andauernden britischen Kolonialismus kämpften. Am Dienstag besuchte Agnes Khoo das Bunte Haus und traf auf rund dreißig interessierte Celler:innen.
Malaya
Aufgewachsen in Singapur hat Khoo familiäre Verbindungen nach Malaysia und besitzt die niederländische Staatsbürger:innenschaft. Sie lehrte an verschiedenen Universitäten in Europa, Asien und Afrika. Mittlerweile war es ihr vierzehnter Vortrag innerhalb von drei Wochen. Das straffe Reiseprogramm ließ sich Khoo nicht anmerken. Bemerkenswert lebendig gab sie einen Abriss der Unterdrückungsgeschichte Malayas – was die Bezeichnung für Malaysia und Singapur als ein Land ist und als wichtige linke Perspektive benannt wurde.
„Wir sind ein Produkt der Geschichte“
Khoo stellte auf sehr persönlicher Ebene die Bedeutung alternativer Geschichtserzählung hervor: „Die Erkenntnis, dass mein Volk für seine Unabhängigkeit gekämpft hat und sie uns nicht – wie uns in der Schule beigebracht wurde – von der ‚großzügigen, britischen Kolonialmacht‘ gegeben wurde, veränderte alles für mich. Für mich bedeutete es, mich gerade zu machen und stolz auf mich und mein Volk zu sein. Wir sind ein Produkt unserer Geschichte. Sie zu kennen bedeutet, zu verstehen, wer wir heute sind.“
Insbesondere der Perspektive und Geschichte von Frauen muss hierbei wesentlich mehr Bedeutung gegeben werden, findet die Soziologin. Durch den Ausschluss der Frauen von Bildung über Generationen hinweg, sei deren Geschichte noch viel weniger festgehalten, als die der „kleinen Leute“. Doch genau von dieser ist sie, so zeigt sich Khoo überzeugt, ein wesentlicher und entscheidender Teil.
Zweihundert Jahre kolonisiert
Malaya ist seit der zweiten Hälfte des 18. bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts britisch kolonisiert worden. Im zweiten Weltkrieg wurde diese Herrschaft für knapp vier Jahre durch eine japanische Besatzung unterbrochen. Die 1930 gegründete CPM nahm in diesem Moment den bewaffneten Kampf gegen die Unterdrückung auf – mit Unterstützung durch die britische Krone. Die Guerilla schaffte es, die Besatzer zu vertreiben, woraufhin wenige Wochen der „wahren Demokratie und Selbstorganisierung“ unter der Kontrolle der CPM in Malaya einkehrten.
Doch bald kehrte die alte Kolonialmacht zurück und ging mit voller Härte gegen die kommunistische Bewegung vor. Mithilfe des 1960 erlassenen antikommunistischen „Internal Security Act“ (ISA) brachten zunächst die Kolonisten und später die neuen unabhängigen Regierungen die politische Opposition hinter Schloss und Riegel. Das Gesetz verlangt keine Beweise und keinen Gerichtsprozess und ist bis heute gültig.
70 Jahre Befreiungskampf
Nachdem ein erster Friedensprozess 1955 an den entstehenden unabhängigen Regierungen scheiterte, führte die Guerilla ihren Kampf aus den tropischen Regenwäldern fort. Im Laufe der Zeit zogen sie sich bis nach Thailand zurück, wo sie mehr oder minder geduldet wurden.
Die CPM legte ihre Waffen schließlich nach knapp 70 Jahren entschlossenem Kampf 1989 im Rahmen eines Friedensabkommens mit den Staaten Malaysia und Thailand nieder und zerstörte sie eigenhändig. Den ehemaligen Kämpfer:innen wurden von der thailändischen Regierung kleine Landstücke als, zwar vererbbares aber unverkäufliches, Eigentum zugewiesen, um sich ein ziviles Leben aufbauen zu können. Ein Drittel kehrte nach Malaysia zurück, während sich 800 von 1200 CPM-Mitgliedern entschieden, sich ein gemeinsames Leben auf diesem Land aufzubauen. Hieraus entstanden die „Friedensdörfer“, in denen sie bis heute ein kollektives Leben als organisierte Menschen führen.
„Die persönliche Sichtweise auf das Leben“
Für die Recherche zu Ihrem Buch besuchte Agnes Khoo Frauen, die sich nach dem aktiven Widerstand 1989 in Friedensdörfern im Süden Thailands niedergelassen haben. „Was mich an den Widerstandskämpferinnen in den Bann zieht, ist ihre feministische Perspektive. Während in den Erzählungen der Männer immer das große, geopolitische Bild mitschwingt, ist mir aus den Gesprächen mit den Frauen vor allem die persönliche Sichtweise auf das Leben aufgefallen“, sagte Khoo.
Anhand der Biografien dreier CPM-Kämpferinnen umriss Khoo sowohl deren unterschiedlichen Beweggründe, der Guerilla beizutreten, wie auch ihre Perspektive auf die verschiedenen Bereiche des Lebens. Neben vielen, die diesen Schritt aus politischen Gründen gegenagen seien, habe Khoo auch mit etlichen Menschen gesprochen, die sich der Guerilla anschlossen, um ihr Leben zu verändern. Insbesondere, um Armut oder Gewalt in der Familie zu entkommen.
Von sich heraus Internationalistinnen und Feministinnen
Frauen hätten häufig nur ein Jahr Bildung schulischer Bildung erfahren. Internationalismus und Feminismus hätten sie daher nicht auf Grundlage großer Theorien betrieben, sondern auf natürliche Weise und von sich heraus gelebt. Agnes Khoos Augen strahlten förmlich, als sie von diesen Beispielen erzählte. Die Region war und ist stark multikulturell und multiethnisch, wobei sich Herkunft, Staatsbürger:innenschaft und ethnische Zugehörigkeit häufig unterscheiden. Dementsprechend war es für eine Guerilla-Kämpferin, die keinerlei Wurzeln in Malaya hat, trotzdem völlig selbstverständlich, sich der CPM anzuschließen: „Wie kann ich in Frieden leben, wenn meine Nachbar:innen keinen Frieden haben? Ich habe mich diesem Kampf angeschlossen, um auch selbst in Frieden leben zu können.“
Die Rolle der Frauen in der Guerilla
Frauen hätten in der Guerilla der CPM größtenteils die gleichen Aufgaben übernommen wie die Männer und bewaffnet in der Befreiungsarmee gekämpft. Dennoch hätten sie geschlechtsspezifische Herausforderungen zu meistern gehabt. Der Widerstand gegen die britische Ausbeutung formierte sich im undurchdringlichen tropischen Regenwald zwischen Nordmalaysia und Südthailand. Die Lebensbedingungen waren unglaublich hart, lange Wanderungen in hügeligem Gelände an der Tagesordnung. Allein in dem ständigen schweren Regen Menstruationsbinden zu wechseln, war schlichtweg kaum möglich.
Darüber hinaus erlaubte die CPM Ehen ihrer Mitglieder, weshalb trotz Geburtenkontrolle hin und wieder Kämpferinnnen schwanger wurden. Dies verlangte von den Frauen zunächst die schwierige Entscheidung über eine Abtreibung zu fällen – welche aufgrund gut ausgebildeter medizinischer Fachkräfte in der Regel sicher durchgeführt werden konnten. Und sonst die neun Monate Schwangerschaft in der Guerilla auszutragen, die Gefechte und schweren Wanderungen, die Geburt im Camp im Wald und schließlich, meist zehn Tage nach der Geburt, das Neugeborene aus Sicherheitsgründen wegzugeben. All diese Bürden hatten die Männer nicht zu tragen.
„Manche Frauen sind so viel stärker als manche Männer“
Teils schlossen sich auch Ehepaare gemeinsam der Guerilla an. Khoo erzählte das Beispiels einer Kämpferin, die sie interviewte: Sie wurde mit 14 Jahren verheiratet, bekam kein Jahr später ein Kind, welches jedoch starb. Ihr elf Jahre älterer Ehemann behandelte sie schlecht und schlug sie. Diese beiden traten gemeinsam der CPM bei. Während der Mann bereits nach kurzer Zeit aufgrund der harten Lebensbedingungen die Reihen des Widerstands verließ, kämpfte die Frau bis zum Friedensabkommen mit der Waffe in der Hand. „Manche Frauen sind so viel stärker als manche Männer“, schloss die Soziologin.
„Unsere Herzen waren frei“
Die britische Kolonialmacht – ebenso wie zuvor die janapnischen Besatzer – ging mit äußerster Härte und Brutalität gegen die Kommunist:innen und Unterstützende vor, Inhaftierung und Folter waren unmenschlicher Alltag. Kurz nach ihrer Rückkehr siedelte sie zur besseren Kontrolle des Widerstands ganze Dorfgemeinschaften um. Umgeben von Stacheldraht gab es in diesen „neuen Dörfern“, wie diese Ghetos euphemistisch benannt wurden, nur einen kontrollierten Ein- und Ausgang. Chen Xiu Zhu, eine der Widerstandskämpferinnnen, erinnerte sich: „Sie konnten uns physisch einsperren, aber unsere Herzen waren frei. Wir hatten keine Angst vor dem Tod. So lange wir hinter der Sache stehen, werden Menschen immer einen Weg finden, die Revolution zu unterstützen.“
„Ich bewundere die kurdischen Frauen ehrlich“
In der anschließenden Diskussion wurde Agnes Khoo danach gefragt, ob es in der CPM eine eigenständige Organisierung der Frauen gegeben habe. „In meinen drei bisherigen Wochen in Deutschland konnte ich die kurdische Bewegung kennen lernen und ich bin ehrlich tief beeindruckt davon, dass die Frauen sich in der Guerilla und überall ihre eigenen Strukturen geschaffen haben. Das bewundere ich wirklich sehr“, leitete Khoo ihre Antwort ein. In der CPM habe es keine autonomen Bereiche gegeben, es seien immer alle zusammen gewesen. Hierdurch habe kein Raum bestanden, um der Frauenfrage angemessen nachzugehen.
„Die Frauen haben ihren Spirit nicht verloren“
Kultur verändere sich langsamer als Politik dies kann, meint die Soziologin, daher präge die feudale Kultur noch immer das gesellschaftliche Leben der Region, obwohl dort so starke Kämpferinnen leben. In den Friedensdörfern haben sie zumeist wieder traditionelle Mutter- und Hausfrauenrollen eingenommen, wie es nach dem Kampf in Friedenszeiten so oft passiere. „Aber die Frauen haben ihren Spirit nicht verloren, sie sind immer noch die starken Kämpferinnnen. Das merkt man sofort an der Art und Weise, wie sie sprechen und wie sie sich bewegen“, konstatierte Khoo.
Aufruf zu internationalistischer Liebe und Freiheitskampf
In kurzen Videoausschnitten ließ Khoo die Frauen zu Wort kommen und teilte einige Interviewpassagen aus ihrem Buch. Ihr Vortrag war nicht nur eine Reise in die Vergangenheit. Sie bezeichnet sich selbst als Nomadin, als aktivistische Lehrende und Schriftstellerin: „Gramsci sagte: ‚Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren: Es ist die Zeit der Monster.‘ Wir befinden uns heute in der Epoche der Monster. Wir müssen uns darauf zurückbesinnen, uns unabhängig von Rasse, Hautfarbe und sogar Religion gegenseitig für Freiheit und Gerechtigkeit einzusetzen.“
Während des spanischen Bürger:innenkriegs im Jahr 1936 unterstützten auch einige asiatische Freiwillige in den Pyrenäen den Widerstand gegen den faschistischen Putsch Francos. „Es gab eine Zeit, wo Internationalismus über Patriotismus und Nationalismus gesiegt hat.“ Es ist eine Geschichte, die nicht vergessen werden darf. Agnes Khoo wird sie weitererzählen.