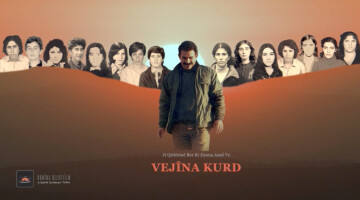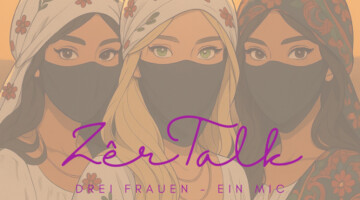Nach der offiziellen Auflösung der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) fordert das Kurdische Frauenbüro für Frieden e.V. (Cênî) die Zivilgesellschaft auf, sich aktiv für eine demokratische und friedliche Lösung der kurdischen Frage einzusetzen. In einer Stellungnahme ruft die Berliner Organisation insbesondere Frauen und Jugendliche dazu auf, den entstehenden politischen Raum mitzugestalten.
Die Auflösung der PKK Anfang Mai erfolgte als Reaktion auf einen Appell ihres inhaftierten Gründers Abdullah Öcalan. Dieser hatte Ende Februar im Rahmen der Gespräche mit Vertreter:innen der Partei der Völker für Gleichheit und Demokratie (DEM) auf der Gefängnisinsel Imrali eine neue Phase des Friedens und der Demokratisierung angestoßen. Die PKK erklärte daraufhin zunächst einen Waffenstillstand und schließlich ihre Selbstauflösung und das Ende des bewaffneten Kampfes.
Öcalans Aufruf als Wendepunkt
In seiner Botschaft bezeichnete Öcalan die Entstehung der PKK als eine Antwort auf die mangelnden Möglichkeiten demokratischer Mitbestimmung in der Türkei. Nun sei es an der Zeit, den bewaffneten Kampf zu beenden und die kurdische Frage auf politischem Wege zu lösen. Der Schritt bedeute jedoch nicht das Ende des Widerstands, sondern seine Überführung in den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft, betont Cênî.
Politischer Prozess statt Repression
Cênî kritisiert die anhaltende Militärgewalt der Türkei gegen Nord- und Ostsyrien und gegen die PKK-Guerilla in Südkurdistan ebenso wie ausbleibende Schritte Ankaras für einen konstruktiven politischen Prozess. Die türkische Regierung zeige keine Bereitschaft „für eine Aufarbeitung des jahrzehntelangen Konflikts und der staatlichen Verbrechen“ in Kurdistan. „Ein echter Wandel kann jedoch nicht einseitig erfolgen“, so das Frauenbüro. Der türkische Staat müsse Verantwortung übernehmen und einen Prozess der Aufarbeitung und Verhandlungen ermöglichen.
„Umso mehr ist unsere Entschlossenheit gefragt. Umso mehr ist unser Widerstand notwendig. Umso mehr müssen wir unsere Prinzipien in die Gesellschaft tragen und für die Selbstbestimmung der Völker, für ein Ende staatlicher und patriarchaler Gewalt, für ein Ende von Ausbeutung und Krieg und für eine radikale demokratische Transformation der Gesellschaft kämpfen. Wir müssen Druck ausüben“, so Cênî.
Kritik des Frauenbüros richtet sich auch an die deutsche Justiz. Die Kriminalisierung kurdischer Aktivist:innen unter dem Vorwurf der PKK-Mitgliedschaft – etwa im Fall der kürzlichen Verhaftung des früheren Ko-Vorsitzenden des kurdischen Europadachverbands KCDK-E, Yüksel Koç – widerspreche den Anforderungen an einen politischen Lösungsprozess.
Rolle der Zivilgesellschaft und Frauenbewegung
In der Erklärung betont Cênî die zentrale Rolle der Zivilgesellschaft für einen dauerhaften Wandel. Die Forderung nach Frieden und Gerechtigkeit dürfe nicht allein an Staaten und Regierungen adressiert werden – sie müsse innerhalb der Gesellschaft organisiert und getragen werden. Besonders Frauen und junge Menschen seien dabei tragende Kräfte.
Kein Frieden ohne Frauenbefreiung
Öcalan habe stets betont, dass echter Frieden nicht ohne die Befreiung der Frau möglich sei. Die kurdische Frauenbewegung sieht darin die Grundlage für eine grundlegende gesellschaftliche Transformation – hin zu einer geschlechtergerechten, ökologischen und demokratischen Ordnung. Die revolutionäre Haltung der Frau sei dabei nicht nur politisches Handeln, sondern ein tiefer Eingriff in die Strukturen von Macht, Patriarchat und Ausbeutung.
Aufruf zum gemeinsamen Engagement
„Jetzt ist nicht die Zeit, sich zurückzulehnen und den weiteren Verlauf wie Außenstehende zu betrachten.“, heißt es in der Erklärung. Vielmehr gelte es, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen – für einen politischen Wandel, für die Aufarbeitung des jahrzehntelangen Konflikts und für ein friedliches Zusammenleben auf der Grundlage von Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. „Mit unserer Entschlossenheit, hinter unseren Prinzipien zu stehen und für diese zu kämpfen, können und müssen wir den weiteren Prozess mitgestalten.“