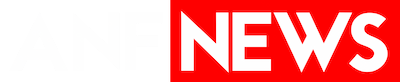Tausende Schüler:innen in der Türkei und Nordkurdistan sind aus ökonomischen Gründen oder auf Druck der Familie gezwungen, in Internaten und Wohnheimen von religiösen Orden unterzukommen. Es häufen sich Berichte über sexualisierte Gewalt, aber vor allem auch über systematische Indoktrination und Psychoterror. Nach dem Suizid des Medizinstudenten Enes Kara, der einen Abschiedsbrief und ein Video hinterließ, in dem er erklärte, dass er die tägliche Indoktrination im Wohnheim des islamisch-fundamentalistischen Nur-Ordens nicht länger ertrug, beginnen nun immer mehr ehemalige Studierende und Schüler:innen über ihre Erlebnisse in den Internaten und Wohnheimen der Orden zu sprechen.
Eine Studierende am ASFA-Kolleg des Nakschibendi-Ordens, die ihren Namen nicht nennen will, berichtet gegenüber ANF über die Situation in den Wohnheimen. Sie besuchte das Internat, um von ihrer Familie wegzukommen, anders wäre es nicht möglich gewesen, „am Leben zu bleiben“ und ein Stipendium zu erhalten.
Sie erzählt: „Diejenigen, die seit der Grundschule oder dem Kindergarten an dieser Schule ausgebildet wurden, fragten mich immer wieder: ‚Warum hast du diesen Ort gewählt?‘ Für mich war es der einzige Ort, den meine Familie akzeptieren würde. Ich wusste sowieso nicht wirklich, an was für einen Ort ich kommen würde. Ich war noch klein, aber ich lernte ihn im Laufe der Zeit kennen.“
„Indoktrination: Lernen war nicht möglich“
Das Kolleg bietet für Schüler:innen, die mehr als 490 Punkte bei den Aufnahmeprüfungen erhalten haben, Stipendien, Dienstleistungen, Unterbringung und Versorgung an. Mit welchen Bedingungen dies Verknüpft sein würde, ist der jungen Frau nicht klar gewesen. In den Häusern des Ordens leben 13 bis 14 Personen, mit vier Personen in jedem Raum. Das Essen wird geliefert, die Bewohner:innen sind selbst für die Reinigung verantwortlich. In den Häusern, in denen diese Jugendlichen im Gymnasialalter wohnen, befinden sich „große Schwestern“, die an der Universität studierten. Abgesehen davon gibt es keine Sicherheit oder ein System zum Schutz der Minderjährigen. Stattdessen wird strenger Religionsunterricht durchgeführt. Die Frau berichtet: „Wir wurden früh zum Morgengebet geweckt. Am Abend mussten wir 40 Minuten religiöse Gespräche führen. Donnerstags fanden Koranrezitationen statt. Alle zwei Wochen gab es am Wochenende Gespräche in Form von Seminaren.“ Diese Veranstaltungen waren allesamt verpflichtend. Aufgrund dieses Pflichtprogramms sei Lernen praktisch unmöglich gewesen.
„Frauenstimmen galten als Sünde“
Die junge Frau berichtet über ihr Schulleben: „Als ich mit der Schule anfing, war ich konservativer. Ich trug ein Kopftuch. Aber ich denke, es ist unnötig zu sagen, dass es sich um Kindesmisshandlung handelt, wenn Mädchen in diesem Alter dazu überredet werden, Kopftücher zu tragen. In der Schule waren Mädchen und Jungen getrennt. Wenn wir zur Schule gingen, dann wiesen uns die Lehrer zurecht. Sie sagten beispielsweise, dieser Ort sei verboten für Mädchen, wir dürften uns nicht im mittleren Hof aufhalten. Wir mussten in einen kleinen Garten im Hinterhof Pause machen. Einmal wurde eine Debatte zwischen dem Jungen- und dem Mädchengymnasium veranstaltet. Im Saal konnten die Jungen vorne sitzen, die Mädchen mussten hinten sitzen. Wenn wir gewannen, hatten die Schülerinnen in der Halle nicht das Recht, sich zu freuen oder zu jubeln, während die Jungen herumbrüllten, wie sie wollten. Ich werde nie vergessen, wie der Lehrer für religiöse Kultur auf die Bühne trat und erklärte ‚Die Stimme der Frauen ist eine Sünde‘.“
„Du bist nicht die Frau geworden, die wir wollten“
Als prägendes Ereignis beschreibt die junge Frau den Besuch eines Lehrers während der Vorbereitungen zu den Prüfungen für die Universitätszulassung in ihrer Unterbringung. Dabei entdeckte der Lehrer Philosophiebücher bei ihr. Sie erinnert sich: „Die Philosophen, die ich gelesen habe, waren auch nicht so extrem. Es ging um Grundlagen wie Platon, Aristoteles ... Trotzdem wurde ich der Schule gemeldet. Vier oder fünf Lehrer an der Schule riefen mich an und sagten: „Wir hatten auch andere Schülerinnen, die hier studiert haben und vom Weg abgekommen sind. Was sind das für Autoren, warum liest du solche Bücher? Du bist nicht die Dame geworden, die wir wollten.‘ Im letzten Jahr bemerkten sie, dass sich meine Haltung geändert hat. Auch wenn ich nichts gemacht hatte, musste ich einmal in der Woche ins Büro des Direktors. Ich wurde auf die schwarze Liste gesetzt. Sie taten alles, was sie konnten, damit ich mich jedes Mal, wenn ich mit ihnen sprach, schlecht fühlte. Sie drohten jedes Mal, wenn wir einen Fehler machten, uns in unserer ökonomischen Lage von der Schule zu werfen. Sie drohten mir, das Stipendium zu streichen und mich aus der Unterbringung zu werfen.“
„Ich erzähle das für die Menschen, die noch dort sind“
Die junge Frau wollte ihren Abschluss machen und Ingenieurwesen studieren. Aber ihr Vater wurde vor dem Abschluss zur Schule eingeladen. Nach dem Treffen mit dem Direktor verweigerte der Vater seiner Tochter das Studium an der Technischen Universität (ODTÜ). Ihr Vater sagte ihr: „Ich schicke dich nicht in dieses Kommunistennest, ich lasse dich nicht dort studieren.“ Obwohl die junge Frau Ingenieurwissenschaften studieren wollte, muss sie nun Medizin studieren.
Die junge Frau erklärt zu den Folgen ihrer Internatszeit abschließend: „Die Folgen hielten lange an, ich schloss mich im Badezimmer ein und blieb dort. Ich dachte, ich sei unbeliebt, ein schlechter Mensch, obwohl ich nichts getan habe. Und dann dachte ich, ich müsste auf mich selbst aufpassen. Damals, mit der Solidarität einer Freundin, begann ich mich wohler und freier zu fühlen, als ich das Kopftuch abnahm. Und jetzt spüre ich die Verantwortung: Es gibt dort immer noch Menschen, die das durchmachen, was ich durchgemacht habe. Außerdem erlebe ich immer noch die Auswirkungen dieser Tage. Ich fühle Solidarität mit ihnen. Deshalb möchte ich ihnen das erzählen. Ich habe mich irgendwie gerettet, aber diese unsichtbaren Hände liegen immer noch um meinem Hals.“