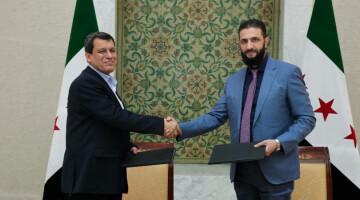Während in Städten explodierende Mieten und Spekulationen auf dem Wohnungsmarkt längst Alltag sind, kämpfen ländliche Regionen zunehmend mit Verödung, Leerstand und sozialer Ungleichheit. Eine mögliche Gegenperspektive darauf bietet ein Modell, das seit einigen Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland radikale Wohnalternativen schafft: das Mietshäuser Syndikat (MHS).
Das Syndikat verbindet solidarische Ökonomie, demokratische Selbstverwaltung und politische Utopie – nicht nur in Großstädten, sondern zunehmend auch auf dem Land. „Das Landleben wird oft vergessen, wenn es um emanzipatorische Kämpfe geht. Deswegen sind Projekte auf dem Land, die sich nicht als etwas Besonderes sehen, sondern als Teil der Landgemeinschaft – aber dennoch andere Themen und Perspektiven mitbringen – etwas sehr Wichtiges“, sagt Friedrich, ein Bewohner des Projekts Hofsyndikat Angersdorf in Bayern.
Wohnen jenseits des Marktes
Im Kern beruht das MHS-Modell auf einem einfachen Prinzip: Häuser werden dem Markt entzogen und dauerhaft dem Gemeinwohl verpflichtet. Jedes Projekt gründet eine eigene GmbH. Diese wird zur Hälfte vom lokalen Hausverein – also der Gemeinschaft der Bewohner:innen – verwaltet. „Jede Person, die hier einzieht, wird automatisch Mitglied im Hausverein“, erzählt Friedrich, „und wenn die Person wieder auszieht, verliert sie die Mitgliedschaft – ganz ohne eigene Geldanteile.“
Die andere Hälfte der GmbH hält das Mietshäuser Syndikat – ein Verein, in dem alle Hausvereine Mitglied sind. Das Syndikat besitzt dabei nur ein Vetorecht bei Verkauf oder Mieterhöhungen. Dieser Mechanismus schützt vor Reprivatisierung, verhindert Spekulation und garantiert, dass einmal geschaffener bezahlbarer Wohnraum auch künftig gemeinnützig bleibt. Was wie eine juristische Feinheit klingt, ist die Grundlage eines solidarischen Netzwerks mit mittlerweile über 200 Hausprojekten in Deutschland und Europa.
Selbstverwaltung in der Provinz
Besonders spannend wird das Modell dort, wo öffentliche Aufmerksamkeit selten hinschaut: auf dem Land. In Niederbayern zum Beispiel hat das Wohnprojekt Hofsyndikat Angersdorf einen Vierseithof umgewandelt. Der Hof bietet nicht nur Wohnraum für 15 Personen, sondern auch vielfältige Gemeinschaftseinrichtungen: eine große Wohnküche, eine Bibliothek, einen Co-Working-Space, eine Sauna, Werkstätten und einen Garten mit essbaren Pflanzen. Ein ehemaliger Pferdestall wurde zu einem Seminarhaus umgebaut, das für kulturelle und politische Bildungsarbeit genutzt wird.
Auch in Brandenburg, Mecklenburg oder der Oberpfalz entstehen auf ähnliche Weise Räume für gemeinschaftliches Leben, Kultur, Werkstätten oder solidarische Landwirtschaft.
Die Motivation ist dabei oft politisch: Viele Projekte verstehen sich als gelebte Kritik an Marktlogik und sozialer Ausgrenzung. Entscheidungen werden basisdemokratisch getroffen, häufig im Konsensverfahren. Aufgaben wie Buchhaltung, Hausverwaltung oder Konfliktmoderation übernehmen die Bewohner:innen selbst. „Wichtig ist aber gleichzeitig zu sagen, dass nicht alle Hausprojekte sich selbst als politisch wahrnehmen oder alles so gemeinschaftlich machen wie wir“, ergänzt Friedrich. „Es gibt auch Projekte, die als Wohngemeinschaften, Einzelwohnungen oder Häuserblöcke funktionieren. Was alle vereint, ist der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum.“
Parallelen zum Demokratischen Konföderalismus
Gerade politische Bewohner:innen erkennen in dieser Struktur Parallelen zu Konzepten wie dem Demokratischen Konföderalismus – einem Gesellschaftsmodell, das auf Selbstbestimmung, ökologischer Nachhaltigkeit und Geschlechtergerechtigkeit fußt, vorgeschlagen von der kurdischen Freiheitsbewegung.
Auch das MHS funktioniert nach föderalen Prinzipien: Autonome Projekte sind durch die Struktur des Syndikats verbunden, organisieren sich weitgehend unabhängig und stimmen sich solidarisch ab. „Die regionalen und bundesweiten Treffen, die jeweils viermal im Jahr stattfinden, sind unser gemeinsames Hauptorgan, um Entscheidungen zu treffen, uns auszutauschen und neue Projekte aufzunehmen“, erläutert Friedrich.
Eine Grundlage für Strukturen in Deutschland
Diese Netzwerkkultur macht das MHS zu mehr als nur einer alternativen Wohnform – es wird zur sozialen Infrastruktur. Friedrich ergänzt: „Bei Weitem ist es noch kein demokratischer Konföderalismus – aber vielleicht eine gute Grundlage, um solche Strukturen auch in Deutschland in die Praxis umzusetzen.“
Er sieht das MHS, solidarische Landwirtschaften und andere alternative Netzwerke als geeignete Orte, um eine europäische Variante des Demokratischen Konföderalismus auszuprobieren. Da das Mietshäuser Syndikat sich gerade in einer Umstrukturierungsphase befindet, könnte dieser Schritt in den kommenden Jahren konkreter werden.
Solidarisch wirtschaften – ganz ohne Investor
Finanziert werden viele der Projekte über sogenannte Direktkredite: Menschen aus dem Umfeld – Verwandte, Aktivist:innen, Unterstützer:innen – verleihen Geld zu niedrigen Zinsen, oft aus Überzeugung. So gelingt es auch Menschen ohne großes Kapital, selbstverwalteten Wohnraum zu schaffen. Der Rückhalt durch das Syndikat hilft beim Einstieg – ohne Einflussnahme von außen.
„Wir konnten den Hof mit circa 80 Direktkrediten kaufen und mussten dadurch keinen Bankkredit aufnehmen“, erklärt Friedrich. „Unsere Miete besteht nur aus der Tilgung und den Zinsen der Direktkredite sowie den Erhaltungs- und Nebenkosten.“
Im Alltag heißt das: Jede Person zahlt durchschnittlich etwa 170 € Warmmiete. Einen einheitlichen Mietpreis gibt es nicht – stattdessen eine solidarische Miete. Alle paar Monate treffen sich die Bewohner:innen, nennen ihre Wunschmiete, und wenn die Gesamtsumme ausreicht, wird diese so übernommen. Wenn nicht, folgt eine weitere Runde. „Wir brauchen selten mehr als zwei Runden. Oft übersteigt die erste schon unseren Bedarf“, so Friedrich und fährt fort: „Es soll nicht darum gehen, wie groß das Zimmer ist, sondern wie die Person ihre finanziellen Umstände selbst einschätzt. Das ist – so wie wir in dieser Gesellschaft sozialisiert wurden – nicht immer leicht.“
Teil des Dorfes statt Vorzeigeprojekt
Die neue Generation von Hausprojekten denkt das Konzept weiter: ökologische Sanierung, inklusive Wohnformen, offene Räume für Nachbarschaft und Engagement. Das Haus wird nicht nur bewohnt – es wird politisch gelebt. „Wir haben Glück, dass auf diesem Hof schon seit Jahrzehnten alternative Menschen gelebt haben. Für die Dorfgemeinschaft ist das nichts völlig Neues“, sagt Friedrich. „Unser Ziel ist nicht, ein Vorzeigeprojekt zu sein – wir wollen Teil des Dorfes sein“, unterstreicht Friedrich. „Das klappt gut über gemeinsame Baustellen, Feste, Vereinsmitgliedschaften – und vor allem durch viel Reden.“
Gerade im ländlichen Raum, wo leerstehende Immobilien und schwindende Infrastruktur oft zu Resignation führen, zeigen Projekte wie das Hofsyndikat Angersdorf: Eine andere Art zu wohnen – solidarisch, gemeinschaftlich, basisdemokratisch – ist nicht nur möglich, sondern längst gelebte Realität.