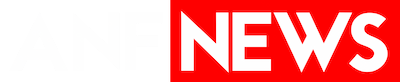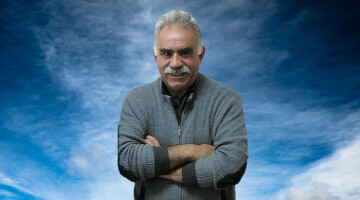Am 28. Januar traf der belgische Kassationsgerichtshof in Brüssel in letzter Instanz die Entscheidung, dass es sich bei der PKK nicht um eine terroristische Organisation handelt, sondern um eine Partei in einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt. Dieses Urteil macht der in Köln ansässige Rechtshilfefonds Azadî in seinem neu erschienenen Infoblatt zum Schwerpunktthema und fordert Konsequenzen.
Diese Zeit muss vorbei sein
Neben zahlreichen Informationen über die Verbotspraxis in Deutschland, einer Übersicht zu juristischen Verfahren und der Situation der kurdischen politischen Gefangenen hält Azadî im Leitartikel fest:
„Mit dem Brüsseler Urteil sollte jetzt eine Zeit anbrechen, in der die deutsche Repressionspraxis und ihre dahinterstehende Interessenspolitik heller beleuchtet werden, als dies bislang geschehen ist. Notwendig ist endlich eine an den Fakten und der Realität orientierte Politik, die die Basis sein müssen für eine ernsthafte Suche nach politischen Lösungswegen. Bisher sind die seit Jahrzehnten vollmundig geäußerten Bekundungen der Bundesregierung, sich stetig für einen Dialogprozess im türkisch-kurdischen Konflikt einzusetzen, nichts als Schall und Rauch. Kein Vorschlag, keine Initiative, keine Forderungen an türkische Regierungen haben das Licht der politischen Welt erblickt. Diese Zeit muss vorbei sein.“
Politik und Justiz in Deutschland ignorieren internationales Recht
Gleichzeitig zeigt Azadî auf, wie festgefahren die politische und juristische Situation in der Bundesrepublik ist. So heißt es außerdem in dem Artikel:
„Wie weit die deutsche Politik und Justiz davon entfernt ist, ihre Haltung zur kurdischen Bewegung zu ändern, zeigt sich exemplarisch an dem am 15. Januar 2020 zu Ende gegangenen §129b-Verfahren gegen den kurdischen Aktivisten Salih KARAASLAN. Seine Verteidigerin, Anna Busl, hatte – wie ihre Kollegen in Brüssel – mit dem Völkerrecht argumentiert, auf das sich die PKK berufen könne. Es gehe eben nicht um Terrorismus. In der mündlichen Urteilsverkündung jedoch habe es das Gericht als „abwegig“ bezeichnet, eine völkerrechtliche Anerkennung anzunehmen und gefragt, was am Tun der PKK humanitär in diesem Sinne sei.
Gerichtsentscheidungen mit Konsequenzen
Im Gegensatz zu dem Brüsseler Urteil des Kassationshofs hat der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in mehreren Revisionsverfahren im Juli 2013 bzw. August 2014 u. a. grundsätzlich entschieden, dass die der PKK zuzurechnenden Straftaten weder durch Völkervertrags- noch durch Völkergewohnheitsrecht gerechtfertigt seien. Auch komme der Artikel 1 Abs. 4 des Zusatzprotokolls (ZP) zu den Genfer Abkommen nicht in Betracht. Seiner Meinung nach stelle der türkisch-kurdische Konflikt „keinen Kampf der PKK gegen Kolonialherrschaft, fremde Besetzung oder ein rassistisches Regime“ dar. Die Türkei habe die überwiegend von Kurd*innen bewohnten Gebiete nicht „zum Zwecke der wirtschaftlichen Ausbeutung oder aus anderen Gründen besetzt“. Eine Fremdbesetzung falle aus, weil die kurdischen Provinzen durch den Vertrag von Lausanne 1923 „völkerrechtlich als Teil der Republik Türkei“ zu betrachten seien. Die kurdische Bevölkerung sei darüber hinaus nicht einem rassistischen Regime ausgesetzt, weil sie nicht „vollständig ausgeschlossen“ werde. Und das Zusatzprotokoll I sei nicht anwendbar, weil es in erster Linie das „früher in Südafrika bestehende Apartheitsregime erfassen“ sollte. Die Konsequenz dieser BGH-Entscheidungen ist, dass sich seither kein Staatsschutzsenat bei den Oberlandesgerichten in §§129a/b-Verfahren mit diesen völkerrechtlichen Fragen auseinandersetzt, ebenso wenig wie mit allen anderen Facetten dieses Konflikts. Die Grundlagen hierfür hat der BGH durch seine Entscheidung vom Oktober 2010 geschaffen. Danach wurde in Stein gemeißelt, dass es sich bei der PKK um eine „terroristische Vereinigung im Ausland“ handelt – „gefestigte Rechtsprechung“ nennt sich das. So werden die Verfahren gegen kurdische Aktivist*innen geschäftsmäßig und routiniert abgespult.“