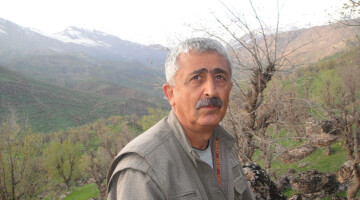Der zwölfte Kongress der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), abgehalten vom 5. bis 7. Mai in den Medya-Verteidigungsgebieten, markiert nach über vier Jahrzehnten bewaffneten Widerstands einen strategischen Wendepunkt in der Geschichte der kurdischen Freiheitsbewegung. In seiner programmatischen Eröffnungsrede formulierte Murat Karayılan, Mitglied des Exekutivkomitees der PKK, eine umfassende Neuausrichtung der Bewegung: weg von der bewaffneten Auseinandersetzung, hin zu einer neuen Ära demokratischer Selbstorganisation und gesellschaftlicher Transformation. „Dies ist kein Ende, sondern ein neuer Anfang. Ein Anfang, der auf einem tiefgreifenden historischen Selbstverständnis beruht“, so Karayılan.
Die „Partei der Gefallenen“
Karayılan eröffnete seine Rede mit einer eindringlichen Würdigung der Gefallenen, allen voran der PKK-Mitbegründer Ali Haydar Kaytan (Fuat) und Rıza Altun. Die PKK sei, so Karayılan, in einer Zeit tiefster Repression, in einem Kontext der kollektiven Auslöschung, durch das Engagement von Abdullah Öcalan und einer kleinen Gruppe politisch bewusster Aktivist:innen ins Leben gerufen worden – unter ihnen jene, die später im Kampf ihr Leben ließen. Die Bezeichnung der PKK als „Partei der Gefallenen“ sei daher keine Rhetorik, sondern Ausdruck einer Tatsache: „Die PKK trat in einer Zeit auf, in der allein ihr Name verboten war. Alles wurde mit Leben, Blut und Widerstand errichtet“, sagte er.
Würdigung verstorbener Weggefährt:innen
„Hevalê Fuat und Hevalê Rıza waren tragende Säulen dieser Bewegung“, sagte Karayılan. Er unterstrich die zentrale Rolle der ersten Weggefährten Öcalans: Während die türkischstämmigen Internationalen Kemal Pir und Haki Karer als ideologische Brückenbauer fungierten, sei Ali Haydar Kaytan als kurdischer Mitbegründer insbesondere aufgrund seiner Herkunft aus Dersim symbolisch für das durch Massaker gezeichnete kollektive Gedächtnis des kurdischen Volkes gestanden. Auch Rıza Altun habe mit seinem politischen Engagement in Ankara einen entscheidenden Beitrag zur Gründungsphase der PKK geleistet. Sie alle seien die „tragenden Säulen“ der Bewegung. Über den kürzlich an den Folgen eines Herzinfarkts in der Türkei verstorbenen DEM-Abgeordneten Sırrı Süreyya Önder, der auch Teil der Imrali-Delegation war und Gespräche mit Abdullah Öcalan führte, sagte Karayılan: „Er ist ein Gefallener der Demokratie, des Friedens und der Freiheit. Ein außergewöhnlicher Mensch mit großer kultureller Tiefe und revolutionärem Geist.“
Der Wandel als Kontinuität
Im Zentrum von Karayılans Rede stand die Anerkennung eines historischen Übergangs. „Der bewaffnete Widerstand hat eine Geschichte geschrieben – eine Geschichte, die in goldenen Lettern in die Historie Kurdistans und der Menschheit eingegangen ist.“ Doch nun sei eine neue Phase erreicht. „Die Strategie des bewaffneten Kampfes müssen wir beenden – nicht aus Schwäche, sondern weil eine neue Zeit beginnt“, erklärte Karayılan.
Die Aufgabe sei nicht weniger revolutionär, sondern auf einer anderen Ebene angesiedelt: „Die PKK hat durch ihren jahrzehntelangen bewaffneten Widerstand nicht nur den Genozid an den Kurd:innen verhindert, sondern die Grundlage für eine gesellschaftliche, politische und kulturelle Wiedergeburt gelegt.“ Die „Revolution des Erwachens“, wie Karayılan es formulierte, sei real und habe sich nicht zuletzt in der Selbstermächtigung der Frauen gezeigt, die heute als tragende Säule der Bewegung gelten.
Die PKK habe eine historische Rolle erfüllt, indem sie dem kurdischen Volk seine Würde zurückgegeben und eine politische Subjektivität jenseits kolonialer Zuschreibungen geschaffen habe, führte Karayılan weiter aus. Die Zeit sei nun gekommen, den Weg für eine neue Phase zu bereiten: einen Kampf, der sich auf gesellschaftliche Mobilisierung, rechtliche Anerkennung und demokratische Organisation stützt.
Eine Geschichte gescheiterter Friedensversuche
Karayılan zeichnete die lange Geschichte gescheiterter Friedensversuche nach – von der ersten Waffenruhe 1993 über die Oslo-Gespräche ab 2009 bis hin zum Dolmabahçe-Abkommen von 2015. Immer wieder seien diese Versuche an der destruktiven Haltung des türkischen Staates und insbesondere an der Intervention nationalistischer Machtzirkel gescheitert. „Es gab Protokolle, Vereinbarungen – doch der Staat akzeptierte sie nicht“, sagte er.
Die strukturelle Gewalt des türkischen Staates, der von einem tief verwurzelten „Verleugnen-und-Vernichten“-Paradigma geprägt sei, habe jede Form echter Annäherung „torpediert“, so Karayılan. Bereits den Versuch der PKK, sich ab 2002 neu aufzustellen und friedliche Wege einzuschlagen, beantwortete der Staat mit harter Repression. Gleichzeitig übte Karayılan auch Selbstkritik: Die Bewegung selbst habe es in früheren Phasen versäumt, den von Öcalan initiierten Paradigmenwechsel vollständig umzusetzen. „Auch wir waren Teil der Blockade“, räumte der Revolutionär ein.
Die programmatische Neuausrichtung der PKK, von der Karayılan sprach, basiert auf dem von Öcalan entwickelten Paradigma des demokratischen Konföderalismus. Dieses Modell versteht sich als Alternative zur kapitalistischen Moderne und zur autoritären Form des Nationalstaats. Es zielt auf die Errichtung einer dezentralen, ökologischen und geschlechtergerechten Gesellschaft ab, die auf Basis selbstorganisierter kommunaler Strukturen funktioniert. Der bewaffnete Kampf, so Karayılan, könne dieses Ziel nicht mehr primär tragen – vielmehr sei ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel erforderlich.

Reformen auf Seiten des Staates notwendig
„Demokratischer Konföderalismus, demokratische Nation, gesellschaftlicher Sozialismus – das ist unsere neue Linie.“ Karayılan betonte, dass dieses Paradigma die Grenzen des Realsozialismus überwunden habe und die Bewegung neu verortet: „Wir sprechen über eine neue Zeit, über den Aufbau demokratischer Moderne im Angesicht kapitalistischer Moderne.“
Diese Neuausrichtung beinhalte die Notwendigkeit struktureller Reformen auf Seiten des türkischen Staates. „Wenn von innerem Frieden gesprochen wird, muss der Staat seine Feindseligkeit beenden“, sagte Karayılan und verwies auf die gesetzliche Anerkennung demokratischer Selbstorganisierung und politische Partizipation kurdischer Akteur:innen. „Die bestehenden Gesetze sind Gesetze der Feindschaft – sie leugnen das kurdische Volk. Wir brauchen rechtliche und gesetzliche Veränderungen, um die Entwaffnung zu realisieren. Ohne rechtliche Rahmenbedingungen und eine neue politische Mentalität ist eine reale Entwaffnung nicht umsetzbar“, betonte er.
Vertrauen ist keine Einbahnstraße
Karayılan unterstrich, dass die Bewegung bereit sei, den Friedensaufruf Öcalans umzusetzen – jedoch nicht unter einseitigen Bedingungen. Eine dauerhafte Lösung verlange gegenseitiges Vertrauen, verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen und das Ende der Militärgewalt. „Wir vertrauen Rêber Apo voll und ganz. Doch um die Waffen wirklich außer Kraft zu setzen, muss auch der Staat Vertrauen schaffen.“
Aktuelle Entwicklungen wie Chemiewaffenangriffe auf die Guerilla trotz eines erklärten Waffenstillstands zeigten jedoch, dass dieser Vertrauensaufbau einseitig ist und untergraben werde, so Karayılan. Zu Vertrauen gehöre aber auch die Freilassung Öcalans. Nur durch seine physische Freiheit könne ein tatsächlicher Dialogprozess entstehen, der auf Augenhöhe geführt werde.
„Es braucht einen echten Wandel“, betonte Karayılan. „Wenn sie den Krieg fortsetzen wollen, sollen sie wissen: Sie können uns nicht besiegen.“ Die kurdische Bewegung habe neue Taktiken, neues Wissen und neue gesellschaftliche Unterstützung – aber auch die Einsicht, dass „die Zeit des bewaffneten Kampfes vorbei ist“. Abschließend erklärt Karayılan: „Dies ist ein neuer Anfang – für die Freiheit, für die apoistische Bewegung, für unser Volk und die Völker der Region. Es ist eine neue Epoche. So sollten wir es begreifen – und so sollten wir handeln.“