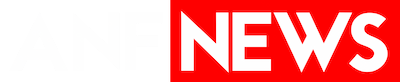Am Samstag hat in Frankfurt die zweitägige Frauenkonferenz „Revolution in the making“ begonnen. Frauen aus vielen Ländern sind angereist, um an der Konferenz unter dem Motto „Die Revolution im Aufbau - Frauen weben die Zukunft“ teilzunehmen. Neben den Diskussionsveranstaltungen finden auch Workshops und Vorträge statt. Einer der Workshops behandelte das Thema „Krieg, Vertreibung und Migration“.
Im ersten Beitrag stellte Samia, deren richtigen Namen wir zu ihrem Schutz nicht nennen, die Revolutionäre Vereinigung der Frauen Afghanistans (RAWA) vor. RAWA ist die älteste politische und soziale Organisation, in der afghanische Frauen seit 1977 für Frieden, Freiheit, Demokratie und Frauenrechte kämpfen. Dabei ging sie auf den langjährigen, aber in der Öffentlichkeit kaum repräsentierten Kampf der afghanischen Frauen ein. Es waren nicht die westlichen Besatzungsmächte, die den Frauen Afghanistans den Kampf gegen das Patriarchat geebnet haben; die unbenannten Vorreiterinnen sind die afghanischen Frauen selbst, sagte Samia. Meena Keshwar Kamal, die Gründerin von RAWA, wurde 1987 in Pakistan von Fundamentalisten ermordet.
Samia hob auch das Motiv der Besatzung Afghanistans hervor, nämlich Krieg. Ein Krieg, in dem erst mit Hilfe westlicher Staaten der Nährboden für fundamentalistische Gruppierungen in Afghanistan geschaffen werden konnte. Die afghanische Frau sei in diesem imperialistischen Krieg dazu verdammt, eine doppelte Bürde zu tragen, so Samia. So schlagen sich Unmut und Verzweiflung in einem seit Jahrzehnten besetzten Land vor allem auf das Leben der Frau in Afghanistan nieder. Nach dem 11. September und der US-Besatzung sei die Gewalt an Frauen gestiegen. Die Unterdrückung der Frau äußere sich in häuslicher Gewalt, Zwangsehe, Vergewaltigung und Mord. Immer mehr afghanische Frauen würden sich selbst verbrennen und es seien die Kriegsherren, die das Leben dieser Frauen bestimmen. Das Leben der Frau verliere an Wert. Die wenigen Frauen im afghanischen Parlament sind laut Samia Repräsentantinnen eines unterdrückenden Systems. Deshalb plädiert sie als Repräsentantin von RAWA dafür, „ohne Furcht zu kämpfen und das System zu verändern. Denn mit Besatzern kommt kein Wechsel.“
Jamila Hami ist langjährige Ärztin bei der kurdischen HilfsorganisationHeyva Sor a Kurdistanê. Sie schließt sich Samia an und betont die Parallelen zwischen Afghanistan und Kurdistan. Besonders die Situation in Efrîn sei vergleichbar. Mit viel Mühe und ohne internationale Unterstützung ist es Heyva Sor in Rojava/Nordsyrien gelungen, den Flüchtlingszustrom nach 2012 aufzufangen. Damals waren viele Orte in Rojava komplett zerstört. Die Demokratisch-Autonome Selbstverwaltung übernahm die Verantwortung für 13 Flüchtlingscamps und schaffte es trotz Embargo, die notleidenden Menschen zu versorgen und die Region wiederaufzubauen. Das türkische Militär attackierte im Jahr 2017 den Kanton Efrîn. Zu dem Zeitpunkt gab es keine Militärbasis, die dort angegriffen werden konnte. Stattdessen wurden Zivilisten und die Infrastruktur der Region zur Zielscheibe eines unbegründeten Krieges. Hami berichtet von 25 Mitgliedern einer Familie, die aufgrund der türkischen Bombardements starben und von zwei Menschen, die sie erst einmal medizinisch versorgte, bevor sie nach dem unmittelbaren Verlassen des Krankenhauses den Bomben zum Opfer fielen.
„In Efrîn fand ein Massaker statt und niemand kam zur Hilfe. Ich habe meinen Glauben an die Menschenrechte verloren. Wo sind die Rechte von Frauen?“
Jamila Hami wurde Zeugin, wie Kinder 25 Tage in improvisierten Bunkern hausen mussten und nach dem Anblick der Zerstörung kein Lächeln mehr über die Lippen brachten. Deshalb appelliert sie an die Frauen der Konferenz, „zusammenzukommen und gemeinsam mit einer Stimme zu sprechen“. Denn es gehe in Rojava schließlich um sechs Millionen Menschen. Die mühsam aufgebaute Infrastruktur in Efrîn wurde zerstört. 12.000 bis 15.000 Menschen leben in Flüchtlingscamps und stehen vor gewaltigen Problemen. Es fehle an vielem. So gäbe es zum Beispiel keine Instrumente für Operationen. Die westliche Gemeinschaft nimmt sich dieser Lager nicht an und zeigt zugleich, wie sie Teil dieses Krieges ist. Eine gemachte Katastrophe des Patriachats.
Resi (Pseudonym, möchte unerkannt bleiben), die dritte Rednerin, stellte die Situation der Migration an den Grenzen Europas – in Ventimiglia in Norditalien vor. Zweck und Ziel der europäischen Grenzpolitik sei die Kontrolle über das Leben der Menschen: „Gerade an den Grenzen wird mit neuen Technologien für Fingerabdrücke an Menschen experimentiert.“ Resi hob in ihrem Beitrag hervor, dass Migranten als Masse von Menschen ohne Gesichter wahrgenommen werden und deshalb unsichtbar seien. Besonders Frauen und LGTB sind die größten Leidtragenden von Flucht, so Resi. Hier sei es wichtig, die Rolle des Kolonialismus zu reflektieren. Es herrschten zwei Herausforderungen für Frauen: Frauen zu sehen und ihnen einen Raum für ihre Bedürfnisse zu bieten. Laut Resi werden Frauen auf der Flucht häufiger ausgebeutet. Sie heiraten westeuropäische Menschen, um reisen zu können oder sind der Prostitution ausgeliefert. Dies sei ein Erbe der Spaltung, sagte Resi. Als weiße Europäerin würde sie eine Sicht darstellen, die sie selbst nicht durchlebt habe. Von ihrer Position aus könne sie nur darum bitten, Frauen und LGBT in dieser schwierigen Situation zu helfen, ihnen Räume für ihre Bedürfnisse zu bieten und diese neue Form von Kolonialismus zu bekämpfen.
Der Workshop mit ca. 40 Teilnehmenden endete mit der Diskussion zur Frage, wie sich die Frauen organisieren können, um gegen koloniale Mächte anzugehen und die Ressourcen der Frauen und Orte zu schützen. Doch vor allem ging es den Teilnehmerinnen darum, sich zu vereinen, um die Dimension eines sozialen Wandels aufzuzeigen und universelle Verbindungen zu knüpfen. Eine äußerst gelungene Veranstaltung mit viel Hoffnung zur Revolution.