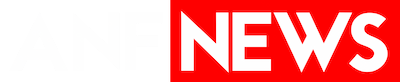Im Schweizer Kanton Genf dürfen Staatsangestellte und Politiker*innen künftig keine Zeichen der Religionszugehörigkeit wie Kopftücher mehr tragen. Die Genferinnen und Genfer haben am Sonntag ein neues Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche angenommen. In einem Referendum stimmten laut Endergebnis mehr als 55 Prozent der Wahlberechtigten für das Gesetz.
Mit dem sogenannten Laizitätsgesetz wird der Grundsatz der Neutralität des Staates in religiösen Fragen bekräftigt. Weiter verbietet das neue Gesetz - bis auf Ausnahmefälle - religiöse Kundgebungen im öffentlichen Raum. Auch die Stellung der Kirchen in finanziellen Fragen wird verbessert. Gegen das Gesetz hatten linke Parteien, Gewerkschaften feministische und muslimische Verbände das Referendum ergriffen. Sie bemängelten den „bevormundenden und diskriminierenden Charakter“ des Gesetzes. Die Regelung sei islamfeindlich und könnte zur Diskriminierung führen, weil Frauen mit einem Schleier oder einem Kopftuch indirekt ins Visier genommen würden. Kritiker*innen warnten zudem, dass das Gesetz möglicherweise gegen die Verfassung verstößt.
Linke wollte Laizitätsgesetz verhindern
Befürworter*innen des „Laizitätsgesetz“ hingegen sahen darin die notwendige Modernisierung eines über 100 Jahre alten Gesetzes des Kantons Genf, „der von jeher als Zentrum religiösen Friedens und Toleranz gilt“. Dieses Gesetz verpflichtet den Kanton zu religiöser Neutralität und zur Trennung von Kirche und Staat. Die Neuregelung hatte das rechtsgerichtete Kantonsparlament im April verabschiedet und wurde dabei von der evangelischen und katholischen Kirche unterstützt. Linke, grüne, feministische und muslimische Organisationen erzwangen daraufhin mit einer Unterschriftenkampagne das Referendum.
Mit dem Ja an der Urne ist der Streit allerdings noch nicht beendet. Am Genfer Verfassungsgericht sind mehrere Beschwerden anhängig.